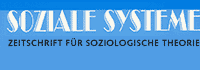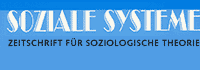Soziale Systeme 1 (1995), H.1,
S. 7-28
Kausalität im Süden
Niklas Luhmann
Zusammenfassung: Politische Entwicklungsplanungen, die rechtliche
und monetäre Mechanismen benutzen, haben sich als wenig erfolgreich
erwiesen. Widerstand gegen Modernisierung ist, infolge dieser Erfahrung,
durch Faktoren wie "Tradition", "Kultur", "Mentalitäten"
erklärt worden. Aber solche Erklärungen sind mehr oder weniger tautologisch
geblieben. Es wird vorgeschlagen, sie durch einen Faktor zu ersetzen,
den man als "soziale Konstruktion" von Kausalität bezeichnen
könnte.
Nach jahrzehntelangen Forschungen über Kausalattribution und Wahrnehmung
kausaler Beziehungen kann man nicht mehr davon ausgehen, daß Beziehungen
zwischen Ursachen und Wirkungen objektive Sachverhalte der Welt
seien, über die dann wahre bzw. unwahre Urteile möglich sind. Vielmehr
geht es um eine Unendlichkeit möglicher Kombination von Ursachen
und Wirkungen, die nur extrem selektiv genutzt werden kann, wenn
ein Zusammenhang von bestimmten Ursachen mit bestimmten Wirkungen
irgendeinen kognitiven oder praktischen Sinn geben soll. In anderen
Worten: Kausalität ist ein Medium lose gekoppelter Möglichkeiten,
dessen Verwendung eine Bildung von relationalen Formen, also eine
feste Kopplung bestimmter Ursachen und bestimmter Wirkungen erfordert.
Aussichten auf erfolgreiches Handeln ebenso wie das Beobachten der
Intentionen anderer hängt von einer solchen Formselektion ab. Dabei
handelt es sich um soziale Konstrukte, deren Konstruktion jedoch
nicht wie eine Meta-Ursache, gleichsam als Ursache der Kausalität
selbst, in das Kausalschema aufgenommen wird. Vielmehr dient die
Formbildung als "blinder Fleck", der es überhaupt erst
ermöglicht, Kausalität zu sehen und zu benutzen.
Wenn eine Gesellschaft daran gewöhnt ist, Kausalität in personalisierten
sozialen Netzwerken zu lokalisieren und Erfolge bzw. Mißerfolge
vom Gebrauch dieser spezifischen Form von Kausalität zu erwarten,
wird es sehr schwierig sein, an diesen Bedingtheiten etwas zu ändern,
wenn nicht als Ersatz gleichermaßen handliche Kausalformen zur Verfügung
gestellt werden können. Mehr Geld und mehr Rechtsvorschriften werden
nur dazu dienen, die Wirksamkeit der Kontakte des Netzwerks zu erproben
und zu bestätigen.

I.
Forschungen über die besonderen Strukturen und Probleme des "Mezzogiorno"
Italiens sind in großer Zahl durchgeführt oder jedenfalls projektiert
und finanziert worden. Im folgenden geht es um eine Revision ihrer
theoretischen Grundlagen.
Im typischen Falle geht man von Unterschieden in der "Kultur"
oder der "Mentalität" der Bevölkerung des Südens aus.
Man hat empirische Befunde genug, die belegen, daß es solche Unterschiede
gibt. Unsere Frage ist, was es besagt und welche Konsquenzen es
hat, wenn sie über Begriffe wie "Kultur" oder "Mentalität"
in die Literatur und in die weitere Forschung eingeführt werden.
Beide Begriffe eignen sich dazu, Unterschiede sichtbar zu machen.
In der Tat ist der Begriff "Kultur" in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts konstruiert worden, um vergleichende Darstellungen,
sei es in regionaler, sei es in historischer Sicht, mit einem übergreifenden
Begriff zu versorgen. Erfolge in Richtung einer Erweiterung des
europäischen Horizontes bis ins Entlegene und Esoterische sind nicht
zu bestreiten. Kultur scheint es immer und überall gegeben zu haben,
solange und soweit es Menschen gibt. Theoretisch hat dieser Begriff
jedoch wenig erbracht. Vor allem ist unklar geblieben, wovon sich
Kultur unterscheidet, wenn alle Artefakte, einschließlich Texte,
einschließlich sogar der jeweiligen Vorstellung von "Natur"
als "Kultur" zu verstehen sind. Ebenso unklar bleibt der
Begriff der Mentalität, der sogar die wichtige Unterscheidung von
kommunikativen und intrapsychischen Prozessen, über die man mindestens
seit der Romantik verfügt, ignoriert oder doch sabotiert. Wenn aber
ein Begriff nicht klarstellen kann, was durch ihn ausgeschlossen
wird, was also die andere, nicht bezeichnete Seite seiner Form ist,
sind wissenschaftliche Erträge nicht zu erwarten. Das mag dazu geführt
haben, daß man sich genötigt sah, "harte" Naturwissenschaften
und "weiche" Geisteswissenschaften (oder "science"
und "humanities") zu unterscheiden. Zugleich könnte hier
einer der Gründe liegen, weshalb die Feststellung von Unterschieden
in der Kultur und den Mentalitäten des Südens im Vergleich zu den
Zentren der modernen Gesellschaft ebenso inspirativ wie unergiebig
geblieben ist. Wissenschaftlich, aber auch politisch.

II.
Daß man so intensiv und so lange mit dem Begriff der Kultur und
mit Mentalitätsvergleichen gearbeitet hat, mag mit bestimmten Eigentümlichkeiten
der neuzeitlichen Semantik Europas zusammenhängen. Wir konzentrieren
uns auf zwei Konzepte: auf ein vorwiegend technisches Verständnis
von Rationalität und ein vorwiegend liberales bzw. sozialistisches
Verständnis von Freiheit. Die Entstehung von Geisteswissenschaften
scheint das Ergebnis oder auch die Kompensation dafür gewesen zu
sein, daß mit dieser Engführung der Semantik von Rationalität und
Freiheit wichtige Probleme der modernen Gesellschaft nicht zu fassen
waren und dann gleichsam als Restprobleme untergebracht werden mußten.
Der rationalen "Entzauberung" der Welt (Max Weber) entsprach
sehr überzeugend eine Verinnerlichung des Freiheitsverständnisses
und die Dauerklage über Entfremdung im Gebrauch der angeborenen
Freiheit. Aber so überzeugend diese Gegenüberstellung gelungen war:
sie scheint heute eine ausreichende Beschreibung der modernen Gesellschaft
eher zu behindern als zu fördern. Es handelt sich um ein Relikt
der "bürgerlichen" (technisch-rationalen, fortschrittlichen,
liberalen oder sozialistischen) Gesellschaft.
Die Vorstellungen über technische Rationalität gehen zurück auf
eine radikale Vereinfachung des aristotelischen Vier-Ursachen-Schemas.
Für Aristoteles waren Ursachen alle Bedingungen, denen Seiendes
sein Sein verdankt, also neben den Wirkursachen auch das angestrebte
Ende (télos), die bestimmungsbedürftige Materie und die Form. Davon
blieb, soweit es um Kausalität geht, nur eine einzige, die sogenannte
mechanische Kausalität.(1) Das Ergebnis
war eine gewaltige Ausdehnung des Anwendungsbereichs dieser einen
Kausalität. Sie war sozusagen nicht mehr auf ein Zusammenwirken
mit anderen Kausalitäten im schön geordneten Kosmos verpflichtet
und nicht mehr durch deren Interferenzen bedroht und eingeschränkt.
Statt dessen mußte sie sich andere Einschränkungen suchen, etwa
solche der Mathematik (die einen Verzicht auf zeitliche Irreversibilität
implizieren) oder in der Form von empirisch getesteten Kausalgesetzen
oder schließlich in der Form statistischer Wahrscheinlichkeiten
des Erzielens bestimmten Wirkungen durch die Aktivierung bestimmter
Ursachen. Zugleich wurden die Zwecke entteleologisiert, das heißt:
nicht mehr als Komponenten der Kausalität selbst behandelt, sondern
nur noch als Vorstellungen, die den Einsatz menschlichen Handelns
zum Bewirken von Wirkungen motivieren. Die Folge ist: daß Zwecke
einen "Wert" haben müssen und über die Werte einer sozialen
Aufsicht unterliegen oder wie man im 19. und 20. Jahrhundert dann
sagen wird: Institution werden können.
Bei aller Kritik der Konsequenzen moderner technischer Kausalrationalität,
wie wir sie bei Max Weber oder beim späten Husserl finden: die Institutionalisierung
von Rationalität scheint unangefochten in Geltung zu stehen - wenn
nicht in Bezug auf das Privatleben so doch in den Anforderungen
an Organisationen.(2) Die Erwartungen
können sich von der Annahme einer linearen Ursache-Wirkung-Kausalität
schwer lösen. Denn wie sollte man sich eigenes Handeln oder das
Handeln anderer vorstellen, wenn man nicht erwarten könnte, daß
das Handeln im Regelfalle die beabsichtigten Effekte hat. Es ist
kaum denkbar, daß man diese Vorstellung frontal attackiert. So viel
Unplausibilität kann selbst die Wissenschaft sich nicht leisten.
Und trotzdem werden wir fragen müssen, ob Kausalität richtig verstanden
ist, wenn man sie schon durch ihren Begriff auf eine feste, technisch
verfügbare Koppelung von Ursachen und Wirkungen reduziert.
Parallel zur Festlegung auf technisch-rationale Kausalität war
die liberale Theorie vom 17. bis zum 20. Jahrhundert von der Unterscheidung
Freiheit und Zwang ausgegangen. Die Konzeption einer natürlichen,
also angeborenen Wahlfreiheit war immer schon ein Erfordernis der
Ethik gewesen (und dies unabhängig von der Frage der politischen
Freiheit, die man nur auf Städte oder Territorialherrschaften bezogen
hatte). Auch wenn nach den Religionskriegen normative religiöse,
naturrechtliche, ethische Beschränkungen der Freiheit mehr und mehr
in Kontroversen (vor allem: in Begründungskontroversen) gerieten,
blieb die Freiheit des Individuums als gemeinsame Voraussetzung
aller Bemühungen um normative Regulierung zurück. Der moderne Individualismus
eignete sich vorzüglich zur Dekonstruktion alter sozialer Einteilungen,
vor allem solcher der Nationen, der Stratifikation, der Patron/Klient-Gruppierungen,
der Kirchen und Sekten und hatte damit eine neue Funktion, ein Existenzrecht
unter ganz anderen sozialen Bedingungen. Freiheit wurde einerseits
von Zwang unterschieden; andererseits aber auch als in sich beschränkt
gedacht: als Ausschließung von Willkür (licentia), wenn nicht gar
als angewiesen auf vernünftigen Gebrauch.
Wenn im Gegensatz zu Zwang definiert, gerät die individuelle Freiheit
in einen unlösbaren Gegensatz auch zur sozialen Ordnung, die ihr
immer Beschränkungen setzen muß. Rousseau hatte diesen Konflikt
bekanntlich durch Eliminierung aller besonderen Abhängigkeiten in
der Gesellschaft vermeiden wollen, "parce que toute dépendence
particuliere est autant de force ôtée au corps de l'Etat".(3)
Aber um so dramatischer tritt er dann im Verhältnis von Individuum
und Staat auf. Eben deshalb mußte man auf Seiten des Individuums
mit Vernunftzumutungen nachhelfen und auf Seiten des Staates mit
verfassungsrechtlichen Vorkehrungen. Der beides zusammenfassende
Titel lautete bei Rousseau volonté générale.
Diese Konstellation hat die allmähliche Abschwächung der Vernunftzumutung
und den Zusammenbruch der Unterscheidung empirisch/transzendental
überdauert. Sie hat sich zwar als radikaler Republikanismus, als
Ausschaltung aller intermediären Instanzen der Einschränkung von
Freiheit - sei es des Individuums, sei es des Staates - nicht durchführen
lassen. Sie hat gleichwohl die politisch-ideologischen Kontroversen
zwischen Liberalismus und Sozialismus überdauert; denn in diesen
Kontroversen ging es nur um die Art des Zwanges, der die Freiheit
unter modernen Bedingungen einschränkt: staatliches Recht oder kapitalistische
Fabrikorganisation. Sie findet sich, wieder und wieder copiert,
in den Programmen der politischen Parteien demokratischer Staaten
und in ihrer Wahlkampfrhetorik. Und immer ist die Freiheit die positive,
der Zwang die negative Seite dieser Unterscheidung. Man könnte in
Bezug auf diese persistente Prominenz von semantisch codiertem Individualismus
sprechen.
In der offiziellen Kultur herrschen diese Schemata der technischen
Rationalität und der individuell fundierten Freiheit nach wie vor.
Es gibt eine romantische Gegenkultur, es gibt zahllose Ansätze zur
Kritik der modernen Gesellschaft; aber solche Bestrebungen leben
davon, daß das, wogegen sie sich wenden, den ersten Platz besetzt
hält. Und doch gibt es deutliche Zeichen dafür, daß diese beiden
aufeinander abgestimmten Schemata nur noch wie kulturelle Fiktionen
fortexistieren. Denn in der sozialwissenschaftlichen Forschung sind
sie seit langem unter dem Mikroskop empirischer Untersuchungen aufgelöst
worden.
Für die Kausalannahmen gilt dies vor allem dank der sogenannten
Attributionsforschung. Ausgehend von der Frage, wie Kausalität überhaupt
beobachtet werden kann,(4) hat sich
das Interesse auf den Zurechnungsprozeß verschoben. Die Frage lautet
nicht mehr, welche Ursache welche Wirkung hat, sondern wie eine
Zuordnung von Wirkungen auf Ursachen und von Ursachen auf Wirkungen
konstruiert wird; und vor allem: wer bestimmt, was dabei unberücksichtigt
bleiben kann. Und wie immer, wenn die Forschung von Was-Fragen auf
Wie-Fragen umgestellt wird, kommen dabei Strukturen in den Blick,
die den Ausschlag dafür geben, daß bestimmte Zusammenhänge gesehen
und andere ebenfalls mögliche Zusammenhänge nicht gesehen werden.
Die Forschung nimmt, in Begriffe der Kybernetik und der Systemtheorie
übersetzt, die Perspektive eines Beobachters zweiter Ordnung ein.
Das heißt: sie beobachtet, wie Beobachter, die Kausalaussagen machen,
beobachten.(5)
Die Annahme einer im Individuum immer schon gegebenen, also nur
durch Vernunft oder durch Zwang einschränkbaren Freiheit hat ein
ganz anderes Schicksal gehabt: Sie ist als Unterscheidung zusammengebrochen.
Wie soll man unterscheiden können, so ist zu fragen, ob jemand auf
Grund von Freiheit oder auf Grund von Zwang handelt? Das war schon
ein Problem der kantischen Theorie gewesen: Wie soll sich jemand
moralisch frei entscheiden können, wenn er zugleich auch rechtlich
gezwungen werden könnte und das weiß? Oder noch älter: wie kann
jemand nur um der Tugend willen handeln, wenn er weiß, daß Tugend
mit sozialer Anerkennung belohnt wird? Oder heute: handelt jemand,
den man mit Über-Ich vollgestopft hat, frei oder unfrei? Auch hier
wirft uns diese Ambiguität zurück auf ein Problem der Beobachtung
zweiter Ordnung: Wer zieht in solchen Fällen die Grenze zwischen
Freiheit und Zwang? Wer konstruiert die Unterscheidung? Warum diese
und keine andere? Wer ist der Beobachter, der beobachtet, wie ein
anderer sich seine Freiheit und sein Gezwungensein zurechtlegt,
wie er external oder internal zurechnet? Auf Grund welcher Charaktermerkmale
und in welchen Situationen?
Die empirische Sozialforschung, und zwar weniger die Soziologie
als vielmehr die Sozialpsychologie, hat die relativ schlichten,
und eben deshalb wirksamen, Prämissen der technisch-rationalen Kausalität
und der individuellen Freiheit pulverisiert. Aber sie hat keinen
ebenso wirksamen Ersatz geschaffen. Sie hat aufgelöst, aber nicht
rekonstruiert. Daher stellen technisch-rationale Kausalität und
individuelle Freiheit immer noch ihre Ansprüche, besonders an die
Politik. Die Technik soll auf Umweltschonung und Risikovermeidung
umdirigiert werden, was voraussetzt, daß man Effekte kennen und
kontrollieren kann. Die Individuen wollen "emanzipiert"
werden (oder zumindest wird ihnen eine solche Ambition zugemutet).
Und schließlich beruht alle Aufarbeitung von Zivilisationsschäden
- Therapie, Sozialarbeit, Entwicklungshilfe usw. - auf solchen Vorgaben.
Man kann eine Diskrepanz zwischen verfügbarem Wissen und rhetorischen
Formulierungen beobachten, auch eine Diskrepanz zwischen dem, was
man wissen kann, und derjenigen Sprache, mit der man Finanzierungen
erreichen kann. Aber das sind deutlich Übergangssituationen, die
auf bessere Theorieangebote warten.

III.
Auf Grund der Kritik üblicher Vorstellungen über Kausalität und
über Freiheit dürfte es nicht schwer fallen, die in diesen Begriffen
steckenden Beobachtungsdirektiven zu reformulieren. Wir suchen damit
Konzepte, die historisch und regional vergleichende Untersuchungen
anleiten können und die in ihrer theoretischen Prägnanz den Begriffen
"Kultur" und "Mentalität" überlegen sind. Dem
liegt die Annahme zugrunde, daß eine Begriffsrevision nicht nur
die Vorstellungen über Kausalität und Freiheit besser an bereits
verfügbares Wissen anpaßt, sondern zugleich bessere Ausgangspunkte
für vergleichende Untersuchungen bietet. Denn sie ermöglichen es,
davon auszugehen, daß Kausalität nicht einfach eine freischwebende
Konstruktion ist, die nur nach wahr oder unwahr oder Funktionieren/Nichtfunktionieren
zu beurteilen wäre, und daß Freiheit nicht nur ein normatives Postulat
ist in dem Sinne, daß mehr davon (man sagt: "Emanzipation")
gut wäre, sondern daß es sich in beiden Fällen um Konstruktionen
handelt, deren Anwendung unter regionalen und historischen Sonderbedingungen
gelernt werden muß und im Bewährungsfalle nur schwer zu revidieren
ist. Bewährtes läßt sich schwer stornieren, wenn nicht sehr konkrete
bessere Möglichkeiten angeboten werden.
Für einen nach Kausalzusammenhängen fragenden Beobachter ist das
Problem der Zurechnung nur deshalb relevant, weil mit dem Begriff
der Kausalität noch keine Festlegung auf bestimmte Zusammenhänge
zwischen Ursachen und Wirkungen erfolgt. Sowohl in Richtung Ursachen
als auch in Richtung Wirkungen führt Kausalität in Endloshorizonte
- und dies nicht nur in linearer Sukzession (also zeitlich), sondern
zugleich kaskadenhaft in beliebig viele benennbare Mitursachen und
Nebenwirkungen. Hinzukommt, daß wir gewohnt sind, auch mit negativen
Kausalitäten zu rechnen, zum Beispiel mit Unterlassungen, mit Ausfall
von Elektrizität (und natürlich mit Folgen eines Todesfalles); und
daß wir auch Strukturen Kausalität zuschreiben, zum Beispiel der
"Klassenstruktur" der modernen Gesellschaft oder den feedback-Schleifen
der Kybernetik. Viele Zufälle, Vorfälle, Unfälle haben weitreichende
Folgen (so rechnen wir zu!), weil man mit ihnen nicht gerechnet
hatte.
Diese einfache Überlegung zwingt uns, in das Kausalschema eine
Unterscheidung einzubauen, die quer steht zu der Unterscheidung
von Ursachen und Wirkungen. Kausalität ist einerseits ein Medium
des Beobachtens und andererseits eine Form.(6)
Als Medium dient Kausalität, wenn man von massenhaft gegebenen,
aber nur lose gekoppelten, nur hin und wieder, nur unter besonderen
Bedingungen zusammenwirkenden Kausalfaktoren ausgeht. Kausale Formen
ergeben sich dagegen bei festen oder doch im Normalfalle erwartbaren
Kopplungen - so wie man weiß, daß ein Ei zerschellt, wenn man es
auf den Boden fallen läßt, und es nicht davonschwebt (wie es im
Weltraum geschehen würde). Als Medium ist Kausalität die bloße Möglichkeit
einer Zurechnung von Wirkungen auf Ursachen. Als Form ist Kausalität
vollzogene Zurechnung, die von Situationen, aber auch von Auswahlgepflogenheiten
des Beobachters abhängt. Man kann, anders gesagt, Kausalität als
Schema einer möglichen Weltbeschreibung akzeptieren, ohne mit der
spezifischen Zurechnung eines bestimmten Beobachters in bestimmten
Situationen einverstanden zu sein.
Medium und Form sind nicht etwa zwei ontologisch getrennte Existenzweisen.
Vielmehr handelt es sich um ein als Einheit konstituiertes Beobachtungsschema,
dessen Komponenten einander wechselseitig bedingen. So ist auch
Sprache ein Medium, dessen Elemente (Wörter) nur reproduziert werden,
wenn sie fallweise in der Form von Sätzen so kombiniert werden,
daß sie einen verständlichen, kommunizierbaren Sinn ergeben. Auch
Kausalität ist Kausalität nur, wenn und soweit dies spezifische
Medium zu Formen kondensiert - zu Beobachtungen und Beschreibungen
vom Typ "A bewirkt B". Die Form impliziert, daß andere
Kausalverläufe dadurch ausgeschlossen sind - etwa "Nicht-A
bewirkt B". Aber dieser Ausschluß bezieht sich nur auf die
konkret realisierte Kausalität. Er läßt es durchaus zu, daß gleichzeitig
und in riesigen Mengen andere Kausalverläufe realisiert werden.
Das Medium erscheint, anders gesagt, nur in seinen jeweils realisierten
Formen. Als solches bleibt es unsichtbar. Es wird nur dadurch reproduziert,
daß laufend Formen gebildet werden. Würde das (aus welchen Gründen
immer) nicht geschehen, gäbe es auch keine Kausalität. Ferner folgt
aus dieser Unterscheidung Medium/Form, daß das Medium invariant
bleibt, die Formen dagegen variabel reproduziert werden: von Moment
zu Moment andere. Formenbildung erfolgt strikt zeitpunktgebunden,
und nur deshalb ist es von Interesse, nach Möglichkeiten nahezu-identischer
Wiederholung zu fragen im Sinne von: Ein Ei fallen lassen, noch
ein Ei fallen lassen. Alle informationsverarbeitenden Operationen,
seien es Bewußtseinsakte, seien es Kommunikationen, die selbst nur
aus Ereignissen bestehen, suchen und finden Redundanzen, das heißt:
Hinweise in dem, was vorliegt, auf das, was folgen wird. Man denke
zum Beispiel an Wettervorhersage - eine ehemals freie, heute durch
Satelliten und Fernsehen professionell gewordene Praxis. Nur durch
ausreichende Redundanzen kann die sequentielle Reproduktion des
jeweiligen Systems gesichert werden. Nur weil diese Zeitpunktgebundenheit
aller Beobachtungen Wiederholbarkeit zum Problem, ja der Lebenserfahrung
nach zur Ausnahme werden läßt, gibt es ein Problem des Gedächtnisses
und des Lernens. Man kann davon ausgehen, daß die Hauptfunktion
des Gedächtnisses im Vergessen, im Wiederfreimachen von Kapazitäten
für Aufmerksamkeit und für Kommunikation besteht, daß aber eben
deshalb das wiederholt Vorkommende bevorzugt erinnert und über alle
Situationsunterschiede hinweg identifiziert wird. Mit einem Begriff
von Heinz von Foerster (siehe Förster
1948) kann man sagen, daß das Gedächtnis auf laufende "Reimprägnierung"
angewiesen ist, um die heilsame Funktion des Vergessens zu blockieren.
In der diffus erlebten und rasch wieder vergessenen Wirklichkeit
bieten Kausalformen, und zwar deshalb, weil es relationale und damit
außergewöhnliche Formen sind, einen besonderen Anreiz für Erinnerung
und für Lernen. Man erwartet und testet gegebenenfalls Wiederholbarkeit.
Jemand hatte in einer schwierigen Lage geholfen und damit gezeigt,
daß er über Kompetenz und Macht verfügt, die man in ähnlichen Situationen
wiederbenutzen kann.
Die Formen, die man im Kausalschema festlegt, um etwas zu erklären
oder zu planen, fixieren deshalb zugleich Unterscheidungen gegenüber
dem, was außer Acht bleiben und Vergessen werden kann. Das Kausalschema
ist eine Unterscheidungen bewahrende Struktur (vgl. Heylighen
1989). Und selbst wenn Korrekturen notwendig werden, muß man
zurückgreifen können auf das, was sich bewährt hat, und das, was
sich nicht bewährt hat.
Eben deshalb versteht es sich keineswegs von selbst, daß Menschen
oder soziale Systeme über die Fähigkeit verfügen, im Kausalschema
zu lernen und Gelerntes zu kommunizieren. Das ist nicht zuletzt
auch eine Frage der dafür geeigneten Sprache. Und selbst wenn diese
Fähigkeit als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, und
das kann man unter heutigen Bedingungen weltweit unterstellen, ist
es immer noch eine offene Frage, was genau gelernt wird - also wie
Kausalformen auffallen, wie sie über eklatante Unterschiede hinweg
identifiziert werden, welche Rolle dabei Personen spielen in dem
Sinne, daß Kausalannahmen (Macht zum Beispiel), die für eine Person
gelten, für andere nicht gelten, und was für Unterschiede über solche
Unterschiede kulturellen Lernens produziert und reproduziert werden.
Die primäre Funktion von Kausalkonstruktionen dürfte es sein, auf
Unterschiede aufmerksam zu machen und sie zu bewahren; und erst
wie das konkret geschieht (ob zum Beispiel festgemacht an Personen
oder Werkzeugen, an chemischen Eigenschaften oder an Rechten, die
man durchsetzen kann), dirigiert Lernprozesse.

IV.
Auch im Verständnis von Freiheit hilft uns die sozialwissenschaftliche
Kritik auf den Weg. Denn wenn die Unterscheidung von Freiheit und
Zwang implodiert und Freiheit nicht mehr durch ihren Gegenbegriff
als Abwesenheit von Zwang definiert werden kann, muß man ein anderes
Verständnis vorschlagen - oder diesen hochgeliebten Begriff aufgeben.
Die Frage lautet also: woran erkennt jemand, daß er frei ist, wenn
er es nicht daran erkennen kann, daß er nicht gezwungen wird?
Diese Frage verschiebt unser Problem in die weitere Frage nach
den kognitiven Voraussetzungen von Freiheit. Freiheit entsteht überhaupt
erst, wenn man Wahlmöglichkeiten erkennen kann. Freiheit wird, kann
man auch sagen, durch Wissen generiert; was auch heißt: durch Wissen
manipulierbar. Solche kognitiven Bedingungen von Wahlfreiheit nehmen
nicht die Form von Regeln an, die anzuwenden wären. Sie sind deshalb
in ihrer Freiheit begründenden Form nicht leicht zu erkennen. Sie
erzeugen nur einen Bereich möglicher Optionen, der dann durch Regeln
und Präferenzbildung eingeschränkt werden kann. Das heißt auch,
daß - im Gegensatz zu methodologischen Annahmen vieler "kulturvergleichender"
Forschungen - direkte Rückschlüsse von Kultur auf Verhalten nicht
möglich sind.(7)
Akzeptiert man diesen Ausgangspunkt, dann werden zahllose Phänomene
lebendig, ohne daß zunächst eine Ordnung erkennbar wird. Vor allem
wird man die Vorstellung aufgeben müssen, daß Freiheit mit Macht
oder mit sozialem Status korreliert. Das kann der Fall sein, wenn
herausgehobene soziale Positionen mehr Möglichkeiten bieten, sich
Informationen zu beschaffen; aber dann ist wiederum Kognition die
eigentliche Quelle von Freiheit und Status eine von vielen Bedingungen.
Hat ein Chirurg mehr Freiheit, der weiß, welchen Spielraum er bei
der Entscheidung für oder gegen eine Operation und bei ihrer Durchführung
hat; oder ein Obdachloser, der weiß, wo man bei welchem Wetter am
besten übernachtet (Parkbänke, U-Bahnschächte, unter Brücken, in
Eingängen von Bürohäusern), und der weiß, wo man die vom Supermarkt
ausrangierten Lebensmittel findet? In jedem Falle wäre der Obdachlose
am Operationstisch ebenso hilflos wie der Chirurg auf der Parkbank,
wenn es nach Regen aussieht. Der Alltag bietet jede Menge von Belegen:
Der Strom fällt aus, und man sitzt im Dunkeln. Hier sind Raucher
im Vorteil, denn sie wissen, wo die Streichhölzer sind. Nur wenn
der Jugendliche weiß, wo die Jugend des Ortes sich abends trifft,
kann er entscheiden, ob er hingeht oder nicht. Freiheit ist "der
Witz des Gefangenen, mit welchem er nach Mitteln zu seiner Befreiung
sucht".(8) Und ein Politiker (selbst
höchsten Ranges) muß wissen können, wie die Presse auf sein Verhalten
reagieren wird, wenn er entscheiden will, was er öffentlich tut
und was nur im geheimen oder gar nicht.
So gesehen bedeutet ein unvorbereiteter Milieuwechsel zunächst
einmal Freiheitsverlust mit unsicheren Chancen des Wiedergewinns.
Das erklärt zum Beispiel den Widerstand der Einwohner East Londons
gegen den Umzug in die so schön geplanten New Towns im breiteren
Umkreis der Metropole.(9) Weitere Überlegungen
schließen sich an. Freiheit wird in der Gesellschaft symbolisiert,
unter anderem, um Prestige und sozialen Status zum Ausdruck zu bringen.
Aber das kann zu Fehlurteilen führen. Ist die Freiheit eines Chefredakteurs
wirklich so groß, wie man annimmt, wenn es darum geht, was in die
Zeitung aufgenommen wird und was nicht und was auf die erste Seite
kommt oder als eine unvermeidliche Meldung doch eher versteckt wird
(vgl. Rühl 1979)? Oder gibt es hier viel Berufs- und Milieuwissen,
das den scheinbaren Entscheidungsspielraum stark einschränkt, aber
faktisch ihn durch Einschränkung überhaupt erst konstituiert?
Der vielleicht wichtigste Vorzug dieser Annahme, Freiheit werde
durch Kognition erzeugt, liegt im Übergang zu kleinformatigen, geradezu
mikroskopischen Analysen. Die Sequenzen sowohl des bewußten Erlebens
als auch der Kommunikation sind durch relativ kurzfristige Episoden
bestimmt. (Welche Freiheitsgrade hat ein gut erzogener Mensch bei
der Inszenierung einer Begrüßung oder beim Akzeptieren eines Verlustes?)
Gelegenheiten, Alternativen zu sehen, erscheinen und verschwinden
wieder von Moment zu Moment, sie können ergriffen oder auch verpaßt
und nur noch retrospektiv erkannt werden, wenn es zu spät ist. Da
das Leben, das Bewußtsein und die Kommunikation durch dynamisch
stabilisierte Systeme reproduziert wird, ist mit einem dauernden
Übergang von Episode zu Episode zu rechnen. Erst wenn man das einsieht
und es der theoretischen Analyse zugrundelegt, kann man fragen,
welche strukturellen Faktoren Episoden zusammenfassen und oft oder
immer wieder zur Entdeckung von Freiheit oder Unfreiheit führen.
Dann kann man so etwas wie "gute" (= zur Gesellschaft
passende) Erziehung nennen, und man kann in diesem Konzept auch
Bedingungen Rechnung tragen, die auf ständige Konfrontation mit
Zwang hinauslaufen. Die klassische Konzeption der Freiheit durch
Abwesenheit von Zwang wird nicht systematisch ausgeschlossen, so
als ob sie empirisch gar nicht vorkommen könnte; aber sie wird als
ein Grenzfall behandelt, in dem viele oder nahezu alle Episoden
durch ein und dieselbe Quelle von Zwang determiniert sind - etwa
bei Entführungen.
Die Freiheit konstituierende Funktion von Wissen ist unabhängig
vom Streit der Erkenntnistheorien (realistisch, idealistisch, pragmatistisch,
konstruktivistisch) und von der Wissenschaft selbst. Ein Wissenschaftler
muß natürlich etwas vom Fach und von Finanzierungsmöglichkeiten
verstehen, wenn er in Bezug auf seine eigenen Forschungen frei entscheiden
will. Aber diese Freiheit besteht auch dann, wenn die Ausgangsannahmen
sich später als falsch erweisen; und sie ist natürlich auch unabhängig
davon, ob seine Forschungen Hypothesen verifizieren oder falsifizieren
oder, wie so oft, dies weiteren Forschungen überlassen müssen. Freiheit
ist ein soziales Konstrukt, und Wissen ist die Form, in der Beschränkungen
eingeführt werden, um Entscheidungen zu ermöglichen. Kognitive Erwartungen
unterscheiden sich, unter anderem wegen dieser Funktion, grundsätzlich
von normativen Erwartungen; denn formulierte Normen provozieren
geradezu die Freiheit, gegen die Norm zu verstoßen. Das Paradies
war der Ort für einen Modellversuch in genau dieser Frage; und die
Welt verdankt einer mutigen Frau die Folgen des Normbruchs: Unterscheidungsvermögen
und Freiheit. Die Kenntnis des Verbots hat genügt.(10)
Auch wenn Freiheit als Korrelat von Wissen überall entstehen kann
und auch, wenn soziale Stratifikation kein sicherer Indikator für
Freiheitsverteilung in der Gesellschaft ist, müssen doch weitere
Faktoren beachtet werden, die differenzierend wirken. In einer Hinsicht
geht es erneut um ein Attributionsproblem. Was sind die Bedingungen
dafür, daß Freiheit gesehen und auf die Person, die sich entscheidet,
zugerechnet wird? Oder noch schärfer: wovon hängt es ab, daß derjenige,
der von seiner Freiheit Gebrauch macht, sich selbst als Ursache
einbringt. Freiheit ist ja ein Konzept für das Abschneiden der Rückfrage
nach weiteren Ursachen. Wir wissen, daß eine solche Personzurechnung
als Selbstzurechnung wie als Fremdzurechnung kontingent erfolgt
und auch anders möglich ist, also von weiteren Bedingungen abhängt.
Solche Bedingungen können psychischer Art sein; aber man findet
sie auch im System sozialer Kommunikation. Wann wird es ermutigt,
Selbstzurechnung zu kommunizieren, und wann muß man so tun, als
ob gar keine Entscheidung vorliege oder sie von anderen provoziert
wurde (typisch zum Beispiel für Rechenschaftslegung bei kriminellem
Verhalten oder sonstigen Formen auffälliger Devianz(11)).
Eine andere Variable liegt in der Frage, wie weit Freiheit nur
darin besteht, zwischen Grenzsituationen zu wählen. Im eher harmlosen
Kleinformat heißt dies: zwischen Handlung und Unterlassung zu wählen.
Dies läuft zumeist auf eine Wahl zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten
hinaus, wobei die Wahl der einen aus zeitlichen oder ökonomischen
Gründen das Unterlassen der anderen erfordert. Nicht selten sind
aber auch die Fälle, in denen man sich nicht entscheiden kann, eine
bestimmte Möglichkeit zu ergreifen (zum Beispiel wegen des Risikos,
auf das man sich damit einlassen müßte), aber auch nicht weiß, was
man statt dessen tun könnte. Dann liegt das Problem nicht in der
Ökonomie der Ressourcen, für die Modelle rationalen Entscheidens
angeboten werden,(12) sondern es liegt
in Problemen der Unentschlossenheit, der Risikoaversion, der Rigidität
von Präferenzen, also in Systemproblemen, die in einer dynamischen
Gesellschaft eher negativ bewertet werden.
Im tragischen Großformat steht nur noch Inklusion oder Exklusion
zur Wahl. Wenn man nicht "mitmacht" (und wohlgemerkt:
freiwillig mitmacht), wird man aus bestimmten Netzwerken oder sogar
aus dem sozialen Leben schlechthin ausgeschlossen. Solche Wahlsituationen
werden oft als "Moral" dargestellt, um den Ausschluß zu
rechtfertigen.
Sowohl Unterlassen (ohne sinnvolle Alternative) als auch Exklusion
sind Optionen (und wohlgemerkt: Optionen!), die in einen unspezifizierten
Raum führen.(13) Man verliert damit
Anhaltspunkte für weiteres Verhalten. Man verliert die Freiheit,
und zwar genau deshalb, weil man keine kognitiven Anhaltspunkte
findet, die einen Spielraum für freie Wahl konstituieren könnten.
Das sind, wenn in einer Gesellschaft mit solchen Grenzsituationen
gespielt wird, starke Sanktionen - viel stärker als alles,
was über Moral und über sonstige normative Regulierungen erreicht
werden kann; denn Normen geben immer noch die Möglichkeit der Abweichung
frei, ja sind geradezu kognitive Voraussetzungen für die Entscheidung
zur Abweichung.(14) Moralen stützen
sich denn auch, zumindest in älteren Gesellschaften, auf die Unmöglichkeit,
die Grenze zum "unmarked space" zu überschreiten.

V.
Für regional orientierte Forschungen geben die theoretischen Modifikationen,
die an den Begriffen Kausalität und Freiheit ansetzen, nur sehr
abstrakte Anhaltspunkte. Das gilt auch dann, wenn man einbezieht,
daß Kausalität etwas mit einem technischen Verständnis von Rationalität
zu tun hat und Freiheit etwas mit kognitiven Bedingungen der Konstitution
von Sinn.
In einem ersten Schritt kommt es vor allem darauf an, sich von
begrifflichen Voreingenommenheiten zu lösen, die eine ganz andere
historische und gesellschaftliche Situation reflektieren, nämlich
die Situation einiger europäischer Länder (vor allem Englands) im
17. und 18. Jahrhundert. Man kann natürlich, was Wissenschaft betrifft,
viele andere Länder und Namen nennen - neben Bacon (der aber erst
im Laufe des 17. Jahrhunderts eine Modeautor wird), Locke und Newton
auch Galilei und Descartes. Aber entscheidend ist die historische
Verortung im 17. und 18. Jahrhundert - in einer Gesellschaft also,
die in nahezu allen Funktionsbereichen die alte Ordnung aufzulösen
begann, deshalb einen technisch-rationalen Begriff von Kausalität
bevorzugte, um neue Sicherheiten zu finden, und einen Begriff natürlich-individueller
Freiheiten, um alte soziale Einteilungen als entbehrlich behandeln
zu können. Aber es war zugleich eine Gesellschaft, die mit einem
inhaltlich ganz unbestimmten, "offenen" Begriff von Zukunft
auskommen und ihn mit der Semantik des "Fortschritts"
besetzen konnte. Warum aber sollen wir uns in einer völlig anderen
Situation durch begriffliche Vorgaben binden lassen, die damals,
und nur damals, überzeugen konnten?
Die Situation der modernen Gesellschaft am Ende des 20. Jahrhunderts
ist eine andere als die einer Epoche, die man als "transitorische
Moderne" bezeichnen könnte. Es ist keineswegs eine "postmoderne"
Situation. Der einzige Sinn dieser Rede von "postmodernen"
Verhältnissen dürfte darin liegen, sich um ein Begreifen der modernen
Gesellschaft herumzudrücken mit der Behauptung, es sei schon vorbei.
Tatsächlich haben wir aber erst heute die Chance, die moderne Gesellschaft
angemessen zu beschreiben, weil sie erst heute, und zwar in weltweiten
Dimensionen, als beobachtbares und beschreibbares Faktum vor Augen
liegt.
Bei regionalen Vergleichen werden üblicherweise die extremen Unterschiede
an Realisierung der Leistungsmöglichkeiten der Funktionssysteme
hervorgehoben - in erster Linie Unterschiede der wirtschaftlichen
Entwicklung, der schul-/hochschulmäßigen Ausbildung, aber auch der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratisierung des politischen Systems
über politische Parteien und eine Oppositionskultur. Solche Tatbestände
sollen weder bestritten noch bagatellisiert werden. Aber sie enthalten
nichts spezifisch Modernes, sondern waren immer schon vorhanden
gewesen. Lediglich die moderne Weltgesellschaft verleiht ihnen einen
besonderen Aufmerksamkeitswert. Denn man ist jetzt mit ihnen in
einem umfassenden Gesellschaftssystem konfrontiert, und das läßt,
wenn Unterschiede der Realisierung sichtbar werden, diese als unakzeptabel
erscheinen. Aber was kann geschehen, wenn man wiederum nur auf Konzepte
technisch-rationaler Kausalität zurückgreifen kann, etwa der Meinung
ist, daß man Geld zur Verfügung stellen müßte, um die Entwicklung
zu fördern? Auf enttäuschende Erfahrungen reagiert man heute mit
der Theorie des "Sozialkapitals" (Traditionen, Einstellungen,
Prestige und Prominenz), das hinzukommen müsse, um beabsichtigte
Innovationen erfolgreich durchführen zu können. Aber das ist eine
fast schon tautologische Zusatzbedingung, für die es nur sehr enge,
lokale und projektabhängige empirische Indikatoren gibt.
Im übrigen geht man bei der Beschreibung unterentwickelter Regionen
von den vorgefundenen Tatbeständen aus. Inzwischen gibt es jedoch
Anhaltspunkte genug dafür, daß die funktionale Differenzierung der
modernen Gesellschaft solche Tatbestände erst produziert. Typisch
verstärken die Funktionssysteme der Weltgesellschaft vorgefundene
Ungleichheiten, weil es für sie rational ist, Unterschiede zu nutzen.
Nur wer zahlungsfähig zu sein scheint, erhält Kredite. Andererseits
wandert die Arbeit in Billiglohnländer ab; aber dies nur, wenn das
Rechtssystem dank staatlicher Garantien funktioniert. Das weltpolitische
System legt wert auf Ansprechpartner und lokale Adressen in allen
Regionen; aber die Form des souveränen Zentralstaates paßt schlecht
auf tribale oder auf ethnisch und religiös inhomogene Regionen.
Bei den heute aktuellen Problemen - von Problemen des Hungers, der
politischen Korruption bis hin zur Entstehung neuer religiöser Kulte
- handelt es sich keineswegs um Relikte einer vergangenen Ordnung,
die einer Modernisierung unterzogen werden müßten, sondern um direkte
Korrelate der Moderne selbst. Mehr und mehr scheint die moderne
Weltgesellschaft sich mit Problemen zu befassen, die sie selbst
erst erzeugt hat. Auch das läßt es fraglich erscheinen, ob man gut
beraten ist, wenn man meint, die üblichen Mittel wie Kredite oder
Erziehung oder Verfahrensinnovationen in Produktion und Verwaltung
nur verstärkt einsetzen zu müssen, um zu Erfolgen zu kommen.
Die Modernisierungsforschung, mit der die Soziologie nach dem zweiten
Weltkrieg eingesetzt und es zu erheblichen Erfolgen gebracht hatte,
war davon ausgegangen, daß "Modernität" in den einzelnen
Funktionsbereichen wechselseitige Stützfunktionen erfüllen würde;
daß also technisch-industriell fortgeschrittene Produktion, Marktwirtschaft,
wissenschaftliche, nur an eigenen Erfolgsaussichten orientierte
Forschung, schulisch organisierte Erziehung der Gesamtbevölkerung,
politische Demokratie mit wohlfahrtsstaatlichen Ausgleichsfunktionen
und schließlich verbesserte Lebensperspektiven der Einzelmenschen
im Projekt Moderne integriert werden würden und daß die Gesamtentwicklung
einem günstigen Mix von Evolution und Politik überlassen bleiben
könnten. Daran vermag man heute kaum mehr zu glauben. Zu deutlich
sind kaum mehr kontrollierbare Nebenfolgen in ökologischen und demographischen
Hinsichten, in Bezug auf zu hohe Risiken, Zukunftsunsicherheit und
eine auch nur annähernd erträgliche Wohlstandsverteilung zutage
getreten; und auch die Aussichten, dies mit regionalen Besonderheiten,
also mit Entwicklungsrückständen zu erklären, schwinden mit der
Zeit. Im Gegensatz zu jeder klassischen Theorie, die funktionale
Differenzierung wie Arbeitsteilung behandelt hatte, wird man davon
ausgehen müssen, daß gerade die hohe Spezialisierung und Autonomisierung
der Funktionssysteme zu wechselseitigen Belastungen führen wird,
von denen man nicht voraussehen kann, wie sie in Einzelfällen bewältigt
werden können.
Daß es Erfolge geben kann und gegeben hat, sollte natürlich nicht
bestritten werden. Ein dogmatischer Pessimismus ist auf jeden Fall
unangebracht. Die Frage ist nur, ob man mit der vorgeschlagenen
Revision der Annahmen über Kausalität zu besseren Einsichten kommt
- und wenn nicht im Sinne von Erfolgswissen, dann doch im Sinne
von Orientierungswissen.
In der bisherigen Betrachtungsweise ist der Zeitfaktor nicht zureichend
berücksichtigt worden. Man hat Zeit natürlich im Zusammenhang mit
Projekten beachtet, also als Zeit, die man voraussichtlich braucht,
um von der Ursache zur Wirkung zu kommen; oder als Zeitspanne, während
der es vertretbar ist, Umweltveränderungen, die das Projekt betreffen,
außer Acht zu lassen.(15) Aber in
gesellschaftsgeschichtlicher Perspektive ist die vordringliche Frage:
wieviel Zeit bleibt für Modernisierung, wie schnell muß es gehen?
Zu Beginn der europäischen Neuzeit und noch im 17. und 18. Jahrhundert
hatte sich diese Frage nicht gestellt. Modernisierung war kein Projekt.
Man konnte zwar Innovationen beobachten, und dies auch während der
Lebenszeit von Individuen, und der Buchdruck trug dazu bei, neue
Kenntnisse zu schätzen und rasch zu verbreiten. Das hatte
Konsequenzen, zum Beispiel für die Autorität des Alters und für
die Berufung auf Erfahrung (vgl. nur Thomas
1988). Aber es gab keine Dringlichkeit in einer Programmatik
gesellschaftlicher Veränderung. Und es gab diesen Zeitdruck nicht,
weil man keine Vergleichsmöglichkeiten hatte. Europa konnte sich
selbst, so zumindest seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, als eine
dynamische Gesellschaft begreifen, aber der eigene Prozeß der Umstellung
auf technische Innovationen, auf Rechtsreformen, auf schulische
Erziehung usw. hatte nur der Logik des Fortschritts zu gehorchen,
und die Welt im übrigen konnte schließlich kolonisiert werden. Erst
im 20. Jahrhundert wird die Differenzierung von (fortgeschrittenen)
Zentren und (zurückgebliebener) Peripherie zum Problem. Erst jetzt
entsteht aus dem Vergleich von Zentren und Peripherien der Moderne
die Erwartung und der Anspruch auf schnelle Aufhebung dieser im
Konzept der modernen, allinklusiven Gesellschaft nicht zu rechtfertigenden
Differenz. Und während Europa sich im Horizonte einer offenen, weithin
unbestimmten Zukunft Jahrhunderte Zeit lassen und sektorale Fortschritte
(zum Beispiel Industrialisierung) jeweils austarieren und Nebeneffekte
auf andere Sektoren, zum Beispiel auf den Staat abwälzen konnte,(16)
sind unter heutigen Bedingungen keine Zeitreserven mehr verfügbar,
und angesichts der faktisch gegebenen Ungleichheit und ihrer laufenden
Reproduktion durch die Bedingungen funktionaler Differenzierung
wäre es blanker Zynismus, wollte man den benachteiligten Regionen
eine Wartezeit von zwei bis drei Jahrhunderten verschreiben.
Aber wie schnell kann es gehen? Und vor allem: welche perversen
Effekte entstehen allein schon dadurch, daß es schnell gehen muß?

VI.
Einige der Besonderheiten süditalienischer Verhältnisse könnten
durch diesen Zeitfaktor erklärbar sein, also durch die relative
Plötzlichkeit mit der Süditalien einem Vergleich mit Norditalien
oder anderen, "besser" entwickelten Regionen Europas ausgesetzt
worden ist. Die alte Ordnung hatte die Gesellschaftsstruktur auf
eine Einheit von Familie, Eigentum und Stratifikation aufgebaut.
Demgegenüber blieb die Frage, wie Vermögensverhältnisse aus landwirtschaftlichen
Quellen und auf Grund von Handel reguliert und über Generationen
hinweg tradiert wurden, zum Beispiel durch arrangierte Heiraten,
eine Frage zweiten Ranges - wie überall im alten Europa. Ausschlaggebend
war die Einheit von Familie und Vermögen ("alter Reichtum"
im Sinne der aristotelischen Adelsdefinition) als Grundlage gesellschaftlicher
Differenzierung. Im übrigen waren in die Stratifikation - und wiederum:
hier wie auch sonst im alten Europa - Patron/Klient-Verhältnisse
eingebaut, die auch politische Funktionen mitzuerfüllen hatten,
da es keine von der Zentrale aus steuerbaren Lokalverwaltungen,
sondern allenfalls lokale (oft grundherrschaftliche) Gerichte gab.
Diese Ordnung hat den Übergang zu einer primär funktional differenzierten
Gesellschaft nicht überlebt. Die Veränderungen betreffen nicht mehr
nur die Oberschicht, die sich an anderen Prestige- und Einkommensquellen
und nicht zuletzt an der jetzt nationalstaatlich organisierten Politik
orientieren muß. Nach dem zweiten Weltkrieg sind auch die bäuerlich-handwerklichen
Familienökonomien in den Strudel der "Modernisierung"
geraten und verlieren innerhalb von ein bis zwei Generationen ihre
alte Bestandssicherheit, ohne daß auf struktureller Ebene eine Nachfolge
erkennbar wäre.(17) Demographisch
gesehen produzieren die Familien Nachwuchs nicht mehr für Produktion,
sondern für Konsum, also im ursprünglichen Sinne "Proleten".
Im Zusammenhang damit wächst die Bedeutung der Schulen und Universitäten,
die ihrerseits jedoch nicht so organisiert sind, daß sie den Aufgaben
einer sinnvollen Ausbildung und Karriereselektion gerecht werden
könnten. Im Wirtschaftssystem gibt es nun eine am Markt orientierte
industrielle Produktion als primäre Einkommensquelle für alle Schichten.
Entsprechend breitet sich die Geld- und neuerdings auch die Kreditabhängigkeit
in allen Schichten aus - bis in privateste Bereiche wie gestiegene
Konsumansprüche, Scheidungs- und Scheidungsfolgenkosten, Versicherungskosten,
Geldausstattung der Kinder etc. Aber auch in anderen Funktionssystemen
nimmt die Übertragung von Aufgaben auf Organisationen zu. Es gibt
staatliche Verwaltungen, die auf die lokale Ebene durchgreifen,
was immer den Gemeinden oder Regionen an Autonomie konzediert wird.
Es gibt politische Parteien mit Ortsvereinen bis in kleinste Orte
hinein, wobei die Kandidatenselektion durch die Machtkämpfe in den
Parteizentralen bestimmt wird. Es gibt Schulen für die gesamte Bevölkerung,
Krankenhäuser (statt nur Ärzte) und Gefängnisse - also organisatorische
Einrichtungen für die Versorgung jeder Art von Klientel nach Maßgabe
spezifischer Funktionen. Die Funktionssysteme selbst können zwar
nicht als Einheiten organisiert sein, aber im Alltag wirken sie
über die ihnen zugeordneten Organisationen und ziehen auf diese
Weise die entsprechenden Probleme und Bedürfnisse an oder erzeugen
sie sogar erst durch ihr Angebot. Es gibt von dieser Struktur aus
gesehen eigentlich keinen Bedarf für Patron/Klient-Verhältnisse
oder Netzwerke ähnlicher (heute würde man sagen: "privater")
Art.
Aber genau hier liegt das Problem. Man kann gerade in Süditalien
beobachten, daß die Gewohnheit, in Netzwerken der Hilfe, der Förderung
und der erwartbaren Dankbarkeit zu denken, erhalten geblieben, aber
von der gesellschaftlichen Stratifikation auf die Organisationen
übertragen worden ist. Die "ansprechbaren" Ressourcen
liegen jetzt nicht im Eigentum, im Prestige der Familie, in der
Verpflichtung durch Herkunft und in den sozial weiterreichenden,
überlokalen Kontakten einer Oberschicht. Sie werden vielmehr aus
den Kompetenzen "abgezweigt", die Positionen in Organisationen
zur Verfügung stellen. Oft genügt das Prestige einer Position, um
sich für etwas einzusetzen, was mit den Aufgaben des Amtes nichts
zu tun hat. Die Organisation stellt Signale zur Verfügung,
die als Symbole für allgemeine soziale Kompetenzen verwendet
werden können. Das versteht sich freilich nicht von selbst, sondern
muß im Netzwerk selbst durch ständige Bereitschaft erarbeitet, "verdient"
und reproduziert werden. Dazu sind zahlreiche soziale Kontakte erforderlich,
viel mündliche Kommunikation, deren Sinn sich weder aus den Organisationsaufgaben
ableiten läßt noch von unmittelbaren praktischen Zwecken her als
notwendig verständlich ist, sondern eine Art Überschußproduktion
hervorbringt, die der Reproduktion von sozialer Kompetenz und Bereitschaft
dient.
Legt man die Interpretation von Kausalität als Formwahl im entsprechenden
Medium zugrunde und die Interpretation von Freiheit als kognitiv
(und damit sozial) konstituierter Freiheitsspielraum, wird die Persistenz
solcher Muster und ihre selbstläufige Reproduktion besser verständlich.
Auch hier dient Kausalität in erster Linie der Bewahrung und der
Selbstkorrektur von Unterscheidungen - und zwar bezogen auf die
Faktoren, mit denen man immer schon etwas erreichen konnte. An der
Ausgrenzung anderer Möglichkeiten muß festgehalten werden, auch
wenn man laufend lernen muß, Positionen im Netzwerk umzubesetzen.
Offenbar können sich Muster für das Entdecken von Kausalformen,
gerade weil sie sich nicht von selbst verstehen und nicht durch
die Natur schon vorgegeben sind, nicht so schnell ändern, wie es
eine Anpassung an die Strukturen der modernen Gesellschaft erfordern
würde. Man kann sie nicht so schnell durch etwas anderes, noch nicht
Bewährtes ersetzen. (Wie soll man Organisationen trauen, wenn man
niemanden kennt, der sie beeinflußen kann?) Und offenbar sind auch
die kognitiven Bedingungen für die Konstitution begrenzter Freiheiten,
für die Zurechnung auf Absichten (statt auf Ansichten) und damit
für das, was persönlich zurechenbaren Sinn gibt, nicht so rasch
änderbar. Man liest in die Organisationen hinein, was man ohne sie
nicht mehr realisieren kann; und in der Tat: die Organisationen
bieten mit ihrer auf Entscheidung und Kompetenz bezogenen Selbstbeschreibung
zahlreiche Möglichkeiten des Austausches von Gefälligkeiten. Man
kann nicht sagen, man könne es nicht. Und wenn es rechtliche Schranken
des Erlaubten gibt, bietet das Beiseiteschieben der damit gegebenen
Hindernisse um so mehr Gelegenheiten, guten Willen und Hilfsbereitschaft
zu demonstrieren. Eine Funktion des Rechts könnte geradezu darin
liegen, den expressiven Wert der Umgehung oder des bewußten Ausschaltens
oder Einschaltens der juristischen Betrachtungsweise zu steigern.
Die Reproduktion dieses Umgangs mit Kausalität und Freiheit wird
verständlich, wenn man sich die alltäglichen Kommunikationen genauer
ansieht. Mit Watzlawick (siehe Watzlawick/Beavin/Jackson
1974) kann man zwei Ebenen der Kommunikation, mit der speech
act Theorie zwei Typen oder Funktionsrichtungen der Kommunikation
unterscheiden. Auf der einen Ebene geht es um die Themen oder die
Informationen, die behandelt werden - etwa der Auftrag an einen
Handwerker, die Planung eines Ausflugs, Berlusconi oder Ähnliches.
Auf der anderen Ebene geht es um die Einstellung der Beteiligten
zueinander, die zwar nicht explizit mitgeteilt, aber implizit zum
Ausdruck gebracht wird, also der Ausdruck des wechselseitigen Wohlwollens,
der Hilfsbereitschaft, aber auch: daß ein Ja eigentlich ein Nein
bedeutet. Die Kommunikation ist immer paradox insofern, als sie
immer etwas Nichtkommuniziertes mitkommuniziert. Aber es wird erwartet,
daß man versteht - und nicht nachfragt. Nicht selten tritt das Gemeinte
in direkten Widerspruch zum Gesagten; und auch dann wird erwartet,
daß man versteht, aber nicht nachfragt. Daß die Kommunikation in
solchen Fällen ohne greifbare Resultate bleibt, darf nicht mit Überraschung
vermerkt werden, obwohl je nach Sachlage Insistieren zum guten Ton
gehören kann. Teilnehmer wissen, wann man nachfassen kann - und
wann nicht. Jedenfalls ist die Unterscheidung der semantischen (konstativen)
und der pragmatischen (performativen) Aspekte jeder Kommunikation
wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am Spiel und für die zutreffende
Lokalisierung von Kausalitäten und Freiheiten.
Wenn dies ein allgemeines Problem der modernen Kommunikation ist
und zum Beispiel bei der Analyse von Pathologien in der Familientherapie
eine bedeutende Rolle spielt, kann man vermuten, daß im süditalienischen
Kontext gerade die Organisationen aktivierende Kommunikation sich
selbst an diesem Problem der paradoxen Kommunikation orientiert,
und zwar mit Schwerpunktverlagerung in Richtung auf die Ebene der
latenten Kommunikation von Einstellungen - aus welchen Anlässen
und über welche Informationen auch immer. Die Paradoxie der Kommunikation
wird dadurch aufgelöst, daß vorausgesetzt wird, daß verstanden wird,
daß die Informationen eine untergeordnete Rolle spielen und daß
es vor allem auf das Symbolisieren des Netzwerks ankommt, in dem
Gefälligkeiten gehandelt und dazu passende Einstellungen zugemutet
werden. Von selbst bewegt sich nichts - und auch das ist eine wichtige
Voraussetzung dafür, daß das Wohlwollen und Freundschaftsdienste
benötigt und über Prestigezuweisungen reproduziert werden.
Die gleiche Schwerpunktverschiebung in Richtung auf personalisierte
Einstellungskommunikation findet man auch in der Inszenierung von
Kultur. Wissenschaft und Kunst werden in erster Linie als Kultur
gefördert. Die öffentliche Präsentation von Kultur ermutigt zu einer
Rhetorik, die riesige Bedeutungsüberschüsse produziert, ohne erkennen
zu lassen, was daraus und darauf nun folgen würde. Kultur (und die
damit erfaßbaren Themen wie die Familie, die Jugend, Ethik, Dichtung,
Europa etc.) wird als eine sich selbst konsumierende Angelegenheit
zelebriert, fast wie ein Ritual, bei dem das Dabeisein und Gesehen-
und Gehörtwerden zählt. Es geht, könnte man vermuten, um die Schokoladenseite
des Netzwerks oder auch um die Symbolisierung von Gemeinsamkeit
bei stark divergierenden Interessen. Oder um es paradox zu formulieren:
das Interesse an Kultur darf kein Interesse werden.(18)
Je deutlicher die Teilnahmebedingungen erkennbar sind, ohne als
Information kommuniziert zu werden, desto schärfer stellt sich die
harte Alternative von Inklusion und Exklusion. In dem Maße, als
Normen "offizieller" Provenienz und vor allem Fragen der
Geltung und Durchsetzbarkeit des Rechts den Bedingungen persönlicher
Interaktionen unterworfen werden, muß ein neuer, ebenfalls generalisierter
Sanktionsmechanismus erfunden werden; und das ist, unter Rückgriff
auf sehr alte Ordnungsformen, die Unterscheidung von Inklusion und
Exklusion. Und dies gilt auf allen Ebenen: in den Dörfern und in
den Universitäten und in den Beziehungen zwischen Privatwirtschaft
und staatlicher Verwaltung; und vor allem natürlich für die professionellen
und die zahllosen nichtprofessionellen Politiker.(19)
Exklusion kann aber nicht wirklich getestet werden, da sie in den
"unmarked space" führen würde, in dem man keine auswertbaren
kognitiven Strukturen, keine wirksamen Kausalitäten, keine nutzbaren
Freiheiten finden kann. Ausschluß in der Form sozialer Isolierung
existiert gewissermaßen nur als Gerücht und nicht in der Form einer
von Fall zu Fall sinnvoll wählbaren Alternative. Die Reproduktion
des Netzwerkes erzeugt, um es mit einem älteren sozialpsychologischen
Begriff zu formulieren, "pluralistic ignorance" in bezug
auf das, was möglich wäre. Das wiederum bestätigt die in der Kommunikation
reproduzierte Ordnung mit all dem, was man dort und nur dort an
Wirkungsmöglichkeiten und an Freiheit finden kann.
Empiriker könnten daran denken, einen "Peinlichkeitstest"
zu entwickeln. Was wird in der Kommunikation als peinlich empfunden?
Offenbar nicht die Bitte um Hilfe, um Intervention in rechtlich
und organisatorisch geregelte Verläufe (zum Beispiel: Examen, Zeugenvernehmungen
vor Gericht, Reihenfolge in der Bearbeitung von Anträgen, Verteilung
von Krankenbetten und ärztlicher Aufmerksamkeit). Und es ist nicht
etwa deswegen nicht peinlich, weil dafür Bezahlung angeboten wird,(20)
sondern deswegen, weil mit der Bitte um einen Gefallen die Anerkennung
von Kompetenz, von Einfluß, von Macht und von gutem Willen verbunden
ist. Das Netzwerk zahlt und motiviert durch "Honorierung",
das heißt: durch Selbstreproduktion der eigenen Asymmetrien, also
wiederum: durch Reproduktion von Kausalitäten und Freiheiten. Selbstverständlich
sind auch riesige Geldsummen involviert und werden gleichsam mithineingezogen
in den Austausch von Entgegenkommen und Gefälligkeiten. Denn wie
könnte man Freundschaft und zugleich Macht besser beweisen als durch
Eröffnung eines Zugangs zum Geld? Aber Korruption in diesem legalen
Sinne, die es ja überall gibt, ist kein isoliert zu betrachtendes
Phänomen. Vielmehr ist anzunehmen, daß das Netzwerk die Grenze zwischen
Korruption und Nichtkorruption durch eine eigene Supercodierung
verwischt, und vor allem wohl durch die Supercodierung von Inklusion
und Exklusion.
Jeder, der am Netzwerk in diesem Sinne teilnimmt, muß wissen, wie
es funktioniert. Er braucht nicht zu wissen, warum es so
funktioniert, wie es funktioniert. Das Netzwerk benötigt zur Lokalisierung
von Kausalität und Freiheit keine Orientierung an öffentlichen Problemen.
Solche Probleme sind zwar Thema der Kommunikation - aber vorwiegend
deshalb, weil sich die Organisationen, die Anlässe geben zur Kommunikation,
mit ihnen beschäftigen. Die Kommunikation selbst verlagert dann
aber den stets mitgemeinten Sinn auf die Ebene individueller Interessen.
Hier und nur hier festigt sich im Alltag ein Problembewußtsein,
das die Kommunikation in Gang hält. "Individuell" ist
dabei wiederum netzwerkbezogen zu verstehen, also nicht etwa beschränkt
auf persönliche Bedürfnisse und Wünsche von Einzelpersonen. Vielmehr
überleben in diesem Zusammenhang die Familie ebenso wie Patron/Klient-Verhältnisse.
Man setzt sich nicht nur für eigenen Interessen, sondern in erheblichem
Umfange auch, und um so unbefangener, für die Interessen anderer
ein. Das System lebt von Vermittlungen und honoriert sie durch Prestigeverteilungen.
Die erst im 18. Jahrhundert aufkommende Unterscheidung von öffentlich
und privat hat hier noch keine Wurzeln geschlagen. Der "Private"
ist noch der "idiotes", der sich selbst ausschließt. Aber
die Übergangssituation zeigt sich nicht zuletzt darin, daß das System
nicht mehr auf Familienökonomien gegründet ist und daß Vermittlungsrollen
organisationsabhängig geworden sind und die normalen Regulative
der Organisationen stören, wenn nicht sabotieren. So wird es schwierig,
von den Zentren aus Organisationen durch Organisation zu kontrollieren,
denn die Netzwerke stehen den "offiziellen" Zentren nicht
zu Verfügung; sie sind nicht hierarchisch, sondern heterarchisch
konzipiert. So kommt es zu einer eigentümlichen Symbiose von Organisationen
und Netzwerken, die alle planmäßige Durchgriffskausalität zum Scheitern
bringt, aber statt dessen in einem anderen Sinne Formen der Kausalität
und lokalisierbare Optionen im System verteilt.

VII.
Wenn wichtige Probleme in der sozial verbreiteten Einschätzung
von Kausalität und von Wahlfreiheit liegen, sollte verständlich
sein, weshalb eine staatliche Politik solchen Verhältnissen gegenüber
versagt oder allenfalls in ihren Angeboten abgesucht wird auf das,
was sich unter Freunden verwenden läßt. Die Prämissen, daß über
Recht oder über Geld oder schließlich über die Bedingungen der Mitgliedschaft
in formalen Organisationen ein Direktzugriff auf individuelles Verhalten
möglich und allenfalls mit einer Restquote von unvernünftigem, unökonomischem
oder schlichtweg kriminellem Verhalten belastet sei, treffen nicht
zu. Und ebensowenig lassen sich die Probleme im Schema Liberalismus/Sozialismus
politisieren. Denn die Frage ist ja gerade, ob man Zwang so schematisieren
kann, daß eine Disposition über zwingende Macht - sei es daß man
sie als Staatsmacht "demokratisch" kontrolliert, sei es,
daß man sie als Wirtschaftsmacht beseitigt - eine regionale Entwicklung
sozusagen "emanizipiert". Gesellschaft ist ein geschichtliches
System, eine "historische Maschine", die sich in der operativen
Reproduktion von Situation zu Situation immer an sich selbst orientiert
- und das heißt: an dem, was sie aus sich selbst gemacht hat. Oder
um es Nietzscheanisch zu formulieren: ihr irreversibles "Werden"
wird vom "Willen zur Macht" zur "Wiederkehr des Gleichen"
gezwungen. Grosso modo jedenfalls. Es gibt natürlich strukturellen
Wandel, auch solchen tiefgreifender Art. Daß das Patronagesystem
binnen relativ kurzer Zeit vom Fundament in Familieneigentum auf
Positionen in Organisationen umgestellt werden konnte, belegt Tiefgang
und Tempo eines strukturellen Wandels mehr als genug. Eine ganz
andere Frage ist jedoch, ob ein Strukturwandel politisch herbeigeführt
werden kann oder ob er der Evolution überlassen bleiben muß, in
der dann "Planung" eine mehr oder weniger fatale Rolle
spielt. Wir können und brauchen diese Frage hier nicht zu entscheiden.
Wenn man aber annehmen muß, daß ein Gesellschaftssystem, auch in
seinen regionalen Ausprägungen, ein historisches System ist, also
in jeder Situation Erinnerung an Bewährtes aktiviert und sich selbst
anders gar nicht einschätzen kann, liegen skeptische Konsequenzen
auf der Hand. Auch Kybernetiker und Mathematiker zeigen, daß ein
System, das seinen eigenen Output als Input wiedereinführt, für
die eigenen Operationen unkalkulierbar wird und erst recht von außen
nicht wie eine zuverlässige Maschine berechnet werden kann;(21)
und dies, obwohl, ja weil es operativ geschlossen und strukturdeterminiert
operiert.
Forschungen, die Entwicklungen in eher peripheren Gebieten der
modernen Gesellschaft betreffen, können daher kaum, ohne ihren eigenen
Grundlagen zu widersprechen, dem politischen Gestaltungswillen Instrumente
zur Verfügung stellen. Zweifel dieser Art, die heute weit verbreitet
sind, müssen jedoch nicht zur Resignation führen. Sie eröffnen,
im Gegenteil, Forschungsperpektiven anderer Art, die auf eine stärkere
Differenzierung von Politik und Wissenschaft eingestellt sind. Die
diskutierten Konzeptveränderungen in Fragen der Kausalität und der
Freiheit betreffen "autologische" Theorien. Das heißt:
sie können, ja müssen auch auf die Forschung selbst angewandt werden.
Und nichts anderes ist gesagt, wenn man davon ausgeht, daß die moderne
Gesellschaft auf einer funktionalen Differenzierung ihrer primären
Subsysteme beruht. Welche Freiheiten gesehen und welche Kausalitäten
konstruiert werden, variiert daher von System zu System. Wenn man
dem Rechnung trägt, macht das alle Planungen kompliziert, vielleicht
entmutigend kompliziert. Man kann dann weder mit einem ontologischen
Realitätsbegriff arbeiten noch mit einer einfachen zweiwertigen
Wahrheitslogik, die, wenn fehlerfrei angewandt, zu Ergebnissen führt,
deren Wahrheitswerte von jedermann anerkannt werden müssen. Über
derart vereinfachende Prämissen ist die moderne Gesellschaft jedoch
seit langem hinausgewachsen, und dies nicht nur, weil es noch gewisse
"Rückständigkeiten" in der Entwicklung gibt, sondern gerade
auch in der Modernität ihrer Strukturen und Semantiken. Es würde
wenig helfen, wollte man das nicht zu Kenntnis nehmen und weiterhin
von Rationalitätszentrismus einer längst überholten europäischen
Tradition ausgehen.

|