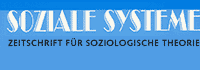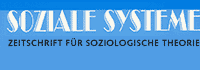Soziale Systeme 5 (1999), H.1,
S. 41-54
Wie der Überfluß flüssig wurde.
Zur Geschichte und zur Zukunft der knappen Ressourcen
Michael Hutter
Zusammenfassung: Die Selbstausgrenzung der Wirtschaft ist entscheidend
abhängig von der internen Installation des Paradoxes der Knappheit.
Das Verständnis der Knappheit ist, das ist die erste These dieses
Beitrags, selbst Ergebnis einer historischen Entwicklung, in der
Knappheit ihrerseits durch die Unterscheidung vom Überfluß konstituiert
wurde. Nachdem Knappheit im Wirtschaftssystem verankert geworden
war, tauchte der Überfluß an der Außenseite des Systems in Form
der "flüssigen" Ressourcen auf. Im Verlauf der Geschichte
wurde die Eigenschaft, Ressource, also Quelle wirtschaftlichen "Mehrwerts"
zu sein, unterschiedlich konstituierten selbstreproduzierenden Systemen
in der Umwelt der Wirtschaft zugeschrieben. Zukünftig, das ist die
zweite These des Beitrags, werden andere Kommunikationssysteme den
größten Teil der knappen Ressourcen ausmachen. Die allen Kommunikationssystemen
gemeinsame Ereignisstruktur wird zu neuen Selbstausgrenzungsformen
der Wirtschaft führen.
1. Zwei Thesen
Die systemtheoretische Rekonstruktion der Wirtschaft zeichnet sich
dadurch aus, daß sie die Wirtschaft als ein sich selbst reproduzierendes
und sich so aus dem Rest der Kommunikationsereignisse ausgrenzendes
Kommunikationssystem beobachtet. Mithilfe der Systemtheorie müßte
man also in der Lage sein, die Geschichte der Wirtschaft als eine
Geschichte ihrer Selbstausgrenzung durch interne Differenzierung
zu rekonstruieren.
Derartige Beobachtungen sind nicht einfach. Wenn man nach Beispielen
für ausgegrenzte Zahlungsereignisse sucht, dann fallen zwar schon
in archaischen Gesellschaften örtlich und zeitlich markierte Tausch
und Handelsereignisse auf. Offenbar wurde dort in einer bestimmten,
von der Umwelt der Ereignisse verschiedenen Weise kommuniziert.
Aber solche Märkte tauchten auf und verschwanden dann wieder. Erst
in der Neuzeit löste sich die Vorstellung der Marktwirtschaft von
diesen physisch bestimmten Ereignissen und begann die gesamte Klasse
von Kommunikationen zu umfassen, die die Eigenschaft einer bestimmten
Codierung aufweisen. Sie machte zunehmend die Transaktionsereignisse
zu Elementen eines Systems, das sich durch die Eigenart seiner Ereignisse
ständig reproduziert. Diese Eigenart lag einerseits in den verwendeten
Zahlungsformen, ausgedrückt in immer stärker selbstreferentiell
produzierten Zahlungsmedien, aber auch in der Eigenart der Fremdreferenz,
mit der im System auf die eigene Umwelt Bezug genommen wurde. Dafür
setzte sich im 19. Jahrhundert die Rede von den "knappen Ressourcen"
durch.
Die Codierung der Wirtschaft, das hat Luhmann
(1988, 179) ausführlich entwickelt, beruht auf dem Paradox der
Knappheit: "Knappheit ist … ein paradoxes Problem. Der
Zugriff schafft das, was er beseitigen will." Dieses Paradox
generiert, im ständigen Hin- und Herspringen zwischen Zugriff und
NichtZugriff, einen endlosen Strom der Kommunikationsereignisse
im System selbst (Hutter 1989, 31). Die Unterscheidung zwischen
Haben und NichtHaben und zwischen Zahlung und NichtZahlung, die
gängigerweise als Codierungen der Wirtschaft beobachtet werden,
beruhen ihrerseits auf der Kommunizierbarkeit einer sozial konstruierten
Eigenschaft, die wir Knappheit nennen.
Diese Eigenschaft ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist, das ist
die erste These dieses Beitrags, selbst Ergebnis einer Entwicklung,
in der Knappheit ihrerseits durch die Unterscheidung vom Überfluß
konstituiert wurde(1). Nachdem Knappheit
zur konstituierenden Eigenschaft im Wirtschaftssystem geworden war,
tauchte der Überfluß an der Außenseite des Systems in Form der "flüssigen"
Ressourcen auf. Im Verlauf der Geschichte wurde die Eigenschaft,
Ressource, also Quelle wirtschaftlichen "Mehrwerts" zu
sein, unterschiedlich konstituierten Systemen in der Umwelt der
Wirtschaft zugeschrieben. Zukünftig, das ist die zweite These des
Beitrags, werden andere Kommunikationssysteme den größten Teil der
knappen Ressourcen ausmachen. Die allen Kommunikationssystemen gemeinsame
Ereignisstruktur wird zu neuen Selbstausgrenzungsformen der Wirtschaft
führen.
2. Von der Hausversorgung
zum Marktüberfluß
Die Geschichte der Selbstversorgung der Gesellschaft reicht mit
ihren Anfängen ins Dunkel der Frühgeschichte zurück. Die folgenden
Anmerkungen sollen einen Eindruck von der Langsamkeit und der evolutionären
Kontingenz dieses Prozesses vermitteln.
Archaische, segmentär differenzierte Gesellschaften bewältigten
ihre Versorgung in einer gemeinschaftlichen, reziprok organisierten
Form. Der Clan oder Stamm folgte den klimatischen und nahrungsbezogenen
Veränderungen seiner Umwelt, die stationäre Dorf- oder Hofwirtschaft
wurde um die Aktivitäten zur Nahrungsproduktion herum organisiert.
Versorgung war etwas, an dem alle Mitglieder der Gemeinschaft beteiligt
waren. Das galt auch noch für komplexere Gesellschaften, in denen
einzelne Häuptlinge oder Könige die politische Führung beanspruchten.
Bis in die Neuzeit hinein behielt deshalb die aristotelische Lehre
von der oikonomia, der Hauswirtschaft, ihre Anwendbarkeit. Noch
die Fürsten der Renaissance, selbst die des ausgehenden 18. Jahrhunderts,
sahen sich in der Rolle des zentralen Herrschers, dessen Rolle die
Versorgung des Gemeinwesens ist (Guerzoni
1999).
Handel kam in dieser Welt im wörtlichen Sinn peripher vor. Seit
der Steinzeit hatte es einige Güter gegeben, von Obsidianschneiden
bis zu Salzplatten, die im Fernhandel über riesige Entfernungen
hin getauscht wurden. Die erste Intensivierung der Versorgung durch
lokalen Handel entstand im griechischen Archipel. Der Handel war
auch in Griechenland ein kurzfristiges, durch Privilegien und Rituale
vom Rest der Gesellschaft isoliertes Ereignis gewesen. Beispielsweise
war der Ort des Tausches durch einen Grenzstein, herm, als heiliger
Ort markiert(2). Der Umfang des lokalen
Handels stieg aber sprunghaft, als Münzformen in Umlauf kamen. Seit
etwa 550 v. Chr. tauchten sie erst an der ionischen Küste und wenig
später in Attika als lokal geprägte Silbermünzen auf. "Schlagartig",
so schreibt Heichelheim, einer der besten Kenner der griechischen
Wirtschaftsgeschichte, breitete sich die Münzwirtschaft aus. Ganz
Griechenland wurde im Verlauf des 5. Jahrhunderts v. Chr. überzogen
mit Münzstätten (Heichelheim
1931, 46). Am zentralen Finanzplatz Athen traten sogar schon
ausdifferenzierte Bankformen und Zinsquotierungen auf.
Dennoch fand die griechische Variation keine evolutionäre Fortsetzung.
Nach der Besetzung durch die Truppen der römischen Republik stagnierte
und verkümmerte die griechische Wirtschaft. Die Erfindung der Silbermünze
überlebte zwar, aber sie blieb in der römisch beherrschten Gesellschaft
ein peripheres Kommunikationsmedium.
Die römische Form der Versorgung war nicht auf wirtschaftliche
Sonderkommunikation angewiesen. Sie basierte auf geplantem Nahrungsmittelanbau
und politischmilitärisch organisierter Verteilung an die Bevölkerung.
Das gleiche Muster war seit den mesopotamischen Flußkulturen praktiziert
worden. Die römische Variante erweiterte und verfeinerte es. Insbesondere
die Verfahren der Konfliktlösung wurden durch neue Rechtsformen
verbessert und flexibilisiert. Handel und Geldgebrauch begleiteten
diese Versorgungsform, die es möglich und schließlich auch erforderlich
machte, im Verlauf von 1000 Jahren große Teile Europas, Nordafrikas
und Vorderasiens zu kolonisieren. Aber sie ergänzten die organisierte
Verteilung nur, denn Handel und Geldgebrauch fanden wieder am Rande
der Gesellschaft statt.
Neue Entwicklungen bahnten sich erst nach dem Zusammenbruch des
römischen Kolonialreiches an. Im nördlichen Europa entstanden seit
dem 7. Jahrhundert Formen der gesellschaftlichen Organisation, in
denen einzelne Familien und Stämme über Lehensherrschaft an eine
zentrale politische Instanz gekoppelt wurden. Gleichzeitig verwendeten
verschiedene politisch differenzierte Gesellschaften die selbe christliche
Heilsreligion. Die Unterscheidung zwischen religiöser und politischer
Codierung ermöglichte eine Kombination zentralisierender und dezentralisierender
Elemente, die in Gesellschaften mit einfacher Hierarchie nicht möglich
gewesen war.
In dieser stärker dezentralisierten Staatenwelt tauchten seit dem
11. Jahrhundert jährlich wiederkehrende, auf wenige Tage und Orte
beschränkte Messen und Märkte auf(3).
Ereignisräume, in denen die unabhängigen Wertungen der Käufer und
Verkäufer durch Friedenspflicht erlaubt waren, wurden aus der religiös
normierten Zeit des Kirchenjahrs und aus der Territorialgewalt der
Herrschaften herauspräpariert. Das geschah über die Vergabe von
Privilegien, die dauernd ausgeweitet wurden, über die aktiven Anstrengungen
von Gemeinden, sich als Marktveranstalter zu etablieren, über "wilde"
Märkte an den Grenzen der Gemeinden, die mit der Zeit toleriert
wurden, aber auch über die kognitiven Erwartungsstrukturen, die
in der Bevölkerung entstanden. Innerhalb der Markt- und Messeplätze
herrschte eine Freiheit und Offenheit, die sie von den religiösen
und politischen Regeln der umgebenden Gesellschaft unterschied.
Bis ins 17. Jahrhundert war der Marktplatz "an island in space
and time, a threshold at which the antagonisms, reciprocities, and
solidarities of a particular locality could be periodically confined
and tempered into the social and cultural matrix of simple or small
commodity production" (Agnew
1986, 39).
So hatte sich in einem Jahrtausende dauernden Prozeß aus der Ordnung
von Religion und Politik eine Zone ausgegrenzt, in der nicht mehr
alles an seinem Platz war. Mit dem Markt war ein Ort entstanden,
an dem Werte auftauchen konnten, die nicht in der Kosmologie schon
angelegt waren. Mit den Märkten war ein zweites Versorgungsprinzip
an die Seite der Verteilung durch die "Magnifizenz" und
die "Munifizenz" des Fürsten getreten. Nicht nur durch
die Herrscher wurden neue Werte generiert, sondern auch durch die
ausgegrenzten, peripheren, temporären Märkte. Bei Beginn des 17.
Jahrhunderts war ganz Europa von lokalisierten Märkten durchzogen(4).
Soviel, in aller Kürze, zur Beobachtung der sich ausgrenzenden
Marktereignisse. Wie aber wurde dieser Prozeß von den Beteiligten
selbst beschrieben und damit kommunikativ faßbar (und damit für
spätere Generationen beobachtbar) gemacht?
Die Beobachtung, daß nicht mehr alles an seinem Platz war, fand
ihren Ausdruck im Begriff des Überflusses. Der Überfluß ist die
Erfahrung der "Fülle" und "Reichlichkeit", die
vordem nur in der Macht der Fürsten gestanden war. Der Überfluß
wurde begreifbar gemacht durch Bilder und Umschreibungen. Ein Beispiel
ist die allegorische Figur der Abbondanza, die, ausgestattet mit
ihrem Füllhorn, mediterrane Marktplätze zierte. Ein anderes Beispiel
ist der Doppelbegriff "power and plenty", den englische
Traktate noch im 17. Jahrhundert als Zielbeschreibung der Wirtschaftspolitik
verwendeten (Viner 1969).
Wir kommen nun zum Auftauchen der Rede von der Knappheit. Das Wachstum
der Märkte in der frühen Neuzeit hing vor allem ab von der Entwicklung
der Geldmedien, mit denen die Zahlungen der Markttransaktionen ermöglicht
und erleichtert wurden. Die Verfügbarkeit von Münzen, in der Regel
Silbermünzen, und die Verfügbarkeit von Kreditinstrumenten wie Schuldscheinen
oder Handelswechseln bestimmte das Ausmaß, in dem sich Einzelne
an den Märkten beteiligen konnten. An diesem Punkt zeigte sich "eines
der Grundprobleme des Lebens im frühneuzeitlichen Europa. Während
des 16. und 17. Jahrhunderts wurde Geld für eine rasch zunehmende
Zahl von Leuten von größter Wichtigkeit, doch gleichzeitig wurde
Bargeld äußerst knapp" (Parker
1983, 335).
Es war also zuerst Geld, von dem man sagte, daß es "knapp"
sei(5). Klagen über Münzknappheit und
Geldmangel nahmen in den Aufzeichnungen von Kaufleuten und Ministern
dieser Epoche breiten Raum ein. Jeder Finanzplatz litt immer wieder
unter vorübergehender Geldlosigkeit, was Unannehmlichkeiten, Panikreaktionen
und zuweilen den Bankrott bedeutete(6).
An diesem Phänomen änderte auch nichts, daß von 1500-1650 an die
200 Tonnen Gold und über 17.000 Tonnen Silber aus Amerika in Spanien
eintrafen. Im Gegenteil, das gestiegene Münzvolumen stimulierte
noch mehr Handel, sodaß sich die Dimensionen der Diskrepanz zwischen
Geld- und gewünschtem Handelsvolumen vergrößerten.
Aus diesen Beobachtungen läßt sich folgender Zwischenschluß ziehen:
Das Herauspräparieren kleiner, ephemerer wirtschaftlicher Sphären,
begehbar in Markt- und Messeplätzen oder personifiziert in Kaufleuten
und ihren Gilden, führte zur zunehmenden Verwendung des Metallgelds,
also eines speziell für Zahlungszwecke geschaffenen Mediums. Dieses
Medium entstand, logisch gesehen, im Inneren des Kommunikationssystems,
denn dort wurden Geldzahlungen hauptsächlich verwendet. Für die
Teilnehmer erschien das Medium aber als eine äußere, das Zahlungssystem
umgebende Schicht, vergleichbar der Erdatmosphäre, die auch die
Erde umgibt, dennoch in ihr, und zwar in ihren organischen Prozessen,
entstanden ist. Es erschien also als äußere Umwelt, was eigentlich
innere Umwelt der sich ausdifferenzierenden Wirtschaft war.
In dieser "Geldatmosphäre" tauchte die Referenz auf eine
Eigenschaft auf, die den Beschreibungen nach erst als ein Mangel
beliebiger Gegenstände wahrgenommen wurde: Knappheit bedeutete eine
dem Zugriff entzogene materielle Menge an Edelmetall. Die Eigenschaft
bezog sich aber auf Objekte, die einerseits materiell, andererseits
aber Bestandteile eines Verständigungsmediums waren. Diese zweifache
Bedeutung unterscheidet den Mangel von der Knappheit. Das Fehlen
der Geldstücke ist anders als das Fehlen eines Nahrungsmittels oder
einer Stoffsorte, es wirkt sich nämlich auf das gesamte eigene Handeln
aus. Darin lag die Ambiguität, die die "falsche" Begriffsverwendung
zur evolutionär erfolgreichen Variante der Wirtschaftsreproduktion
werden ließ. Die psychische Erfahrung(7)
des Mangels und der Entbehrung wurde erfolgreich übertragen auf
die Erfahrung eines kommunikativ konstruierten Mediums, das zeitweise
knapp geworden war. So konnte die selbstgenerierte Verständigung
über die neue Eigenschaft gelingen: an der Knappheit der Geldmünzen
lernte die europäische Gesellschaft, wie die Eigenschaft der Knappheit
kommunikativ verwendet wird.
3. Vom Überfluß
zum Fluß der Ressourcen
Die Reaktion auf die dauernden Metallgeldknappheiten bestand in
einem Schwall von neuen Kreditgeldformen:
Die frühe Neuzeit verzeichnete eine beispiellose Zunahme in der
Verwendung verschiedenster Kreditformen: ungesicherte und gesicherte
Darlehen, Pfandleihe, Schuldscheine, Zahlungsanweisungen, Bankgeld,
Papiergeld und übertragbare Wertpapiere - aller dieser bediente
man sich in steigendem Maße, um die Verwendung von Edelmetallen
zu vermeiden. (Parker 1983, 338)
Der "Industriellen Revolution", so urteilen die Wirtschaftshistoriker,
ging die "Revolution der Finanzmedien" voraus.
Die Expansion der Kreditformen darf man sich aber nicht als größer
werdendes Volumen von Objekten, wie bei den Silbermünzen, vorstellen.
Kreditformen sind Schuldformen, und Schuldformen sind auf Personen
zugerechnete Zahlungserwartungen, die - zumindest in den Formen
seit der frühen Neuzeit - durch starke rechtliche Sanktionen gestützt
wurden. Die eigentliche Neuerung bestand darin, daß sich Personen,
die das Geldwechselgeschäft betrieben, in Netzwerken zu organisieren
begannen: als Netz der oberitalienischen Bank- und Handelshäuser,
als Netz der Gesellschafter der Bank von Amsterdam, als Netz der
englischen goldsmith banks, und so fort. In diesen Netzwerken konnten
Kreditrisiken und -laufzeiten verteilt werden(8).
Der folgenreichste Schritt in der Evolution des Bankennetzes war
vermutlich die erfolgreiche Einführung der Banknoten der (privaten!)
Bank of England. Begünstigt durch eine vom Parlament selbst verfügte
Münzknappheit(9) erreichte diese Bank die
Akzeptanz von Banknoten, deren Kreditwürdigkeit auf das gesamte,
nicht näher präzisierte Steueraufkommen der Krone bezogen war (Hutter
1993). Damit war eine Form gefunden, in der "öffentlicher
Kredit" als Quelle für Zahlungsversprechen verwendet werden
konnte. Als diese Kreditform dann auch noch 1720 die South Sea Bubble-Krise
überstand, hatte die Kreditkommunikation in Europa eine neue Struktur
gefunden. Die Unterscheidung zwischen der Fülle des Souveräns und
dem Mangel des Subjekts war ersetzt durch die Unterscheidung zwischen
öffentlicher und privater Versorgung. Der Souverän begann, sich
von der Aufgabe der Versorgungskoordination zurückzuziehen(10).
Er beschränkte sich auf zunehmend indirekte Steuerung und auf die
öffentliche Versorgung mit einem Geldmedium, das dem privaten Handel
zur Verfügung gestellt wird. Das zweistufige, aus der statlichen
Zentralbank und den privaten Geschäftsbanken bestehende Bankensystem
wird dann im 19. Jahrhundert den vorläufigen Abschluß dieser Entwicklung
markieren.
So wuchs in der Wirtschaftskomunikation der Anteil der über Versprechen
und Erwartungen geschöpften Elemente des Mediums gegenüber den physisch
vorhandenen Elementen. Die notwendige Knappheit des Mediums wurde
künstlich erschaffen und gesichert. Nun wurde erfahrbar, daß Geldknappheit
nicht eine äußere, sondern eine innere Bedingung von Zahlungen ist,
ständig reproduziert vom Netzwerk der Bankenorganisationen(11).
Diese Virtualisierung des Geldmedium machte Angst. Bis in unser
Jahrhundert erzeugt der Gedanke, daß sich der ständige Fluß an verfügbaren
Geldmitteln allein einem Geflecht gegenseitiger Zahlungsversprechungen
verdankt, Schwindelgefühle(12).
Die Internalisierung der Geldreproduktion ging einher mit der Lösung
des Marktbegriffes von raumzeitlich bestimmten Ereignissen. Jetzt
wurde er für alle Akte des Kaufens und Verkaufens von Gütern anhand
von Geldpreisen verwendet. Der Markt bezeichnete eine bestimmte
Art der gesellschaftlichen Verständigung, die sich spezifischer
Kriterien bediente, um die Versorgungsrelevanz bestimmter Güter
festzustellen. Ein "new and boundless silent trade" (Agnew
1986, 50) (13) etablierte sich, der
die Zwischenräume zwischen den Märkten und Messen ausfüllte. Die
Geldversorgung durch das Bankennetzwerk stattete alle gehandelten
Güter mit Geldpreisen aus. So wurde auch ihnen die Eigenschaft zugeschrieben,
die vormals nur am Medium der Verständigung über ihren Tauschwert
beobachtet wurde, denn Zahlungsoperationen kommunizieren durch die
Geldverwendung immer die Knappheitsunterscheidung mit.
Nicht Haushaltführung, sondern Handel war am Beginn des 18. Jahrhunderts
zum paradigmatischen wirtschaftlichen Ereignis geworden. In der
Haushaltswirtschaft endet der wirtschaftliche Impuls immer dann,
wenn die Versorgung mit den angestrebten Gütern erreicht ist(14).
In der Handelswirtschaft sind die Operationen dagegen zirkulär angelegt:
Eine Menge an Geldmitteln wird in Waren, etwa die Schiffe und Geräte
einer Handelsexpedition, umgetauscht. Die Waren produzieren neue
Waren oder sie werden an einen anderen Raumzeitpunkt befördert,
wo sie erneut in Geldkapital umgetauscht werden können. Der "Profitzirkel",
in dem Zahlungsunfähigkeit neue Zahlungsfähigkeit erzeugt, treibt
die wirtschaftlichen Operationen, nicht mehr der stationäre Bedarf
der Haushalte(15).
Dieser Vorgang läßt sich in seiner Bedeutung für die Selbstausgrenzung
der Wirtschaft besser verstehen, wenn wir unterscheidungstheoretische
Kategorien verwenden. Die in der frühen Phase der Marktausgrenzung
beobachtbare Unterscheidung war
Überfluß unmarked state
gewesen(16).
Der Wechsel von der Metall- zur Kreditgeldversorgung ließ die Knappheitserfahrung
von einer Außen- zu einer Innenerfahrung der Märkte werden. Die
neue Konstellation bedeutet eine Unterscheidung in der Unterscheidung
und läßt sich
Überfluß Knappheit unmarked state
schreiben.
Das auf die Banken bezogene Kreditgeld verallgemeinerte die Märkte
zum über Raum und Zeit vergleichbaren Phänomen. Das Verhältnis zwischen
Verfügbarkeit und Begehren war in Geld meßbar geworden und konnte
mit anderen Knappheitsverhältnissen verglichen werden kann. Die
Knappheitserfahrung im universalisierten Markt führte zum Wechsel
der Unterscheidung. Nach 1700 wurde
Knappheit Überfluß unmarked state
zur beobachteten Unterscheidung(17).
Wie wirkte sich das "Umklappen" der internen Unterscheidung
aus? Wie läßt sich dieser Vorgang interpretieren?
Das Marktgeschehen war nun der Ort der Knappheit, auf alle anderen
Operationen wurde Überfluß zugerechnet. Aber der Überfluß wurde
in der neuen Interpretation zweideutig: Die Welt des Überflusses
ist einerseits überflüssig, weil sie mit der Knappheitswertung nicht
beschrieben werden kann. Sie kann andererseits flüssig gemacht werden,
wenn Bestandteile dieser Wirtschaftsumwelt in eine Referenz, einen
Bezug zur Knappheitsreferenz gebracht werden können. Das gelingt
dann, wenn sie Teil einer Produktion werden, in der Objekte und
Leistungen entstehen, die ihrerseits bezahlt werden, und die so
den Zahlungsfähigkeits- oder Profit-Zirkel fortsetzen. Das Paradox
ist internalisiert. Aus dem "Überfluß" wird "Reichtum",
und damit ist der Begriff gefunden, der noch bis ins 19. Jahrhundert
den Kern der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung von Wirtschaft
markiert (Foucault 1971, 211f.).
Die begriffsgeschichtlichen Spuren des flüssig werdenen Überflusses
folgen im wesentlichen zwei Strängen. Der eine verläuft über den
Begriff der "Ressource". Der Überfluß wird als Ressource
flüssig gemacht. Die Ressource unterscheidet sich von der "Source",
der Quelle. Die Quelle bezeichnet - ähnlich dem Füllhorn - den Punkt,
an dem Überfluß in die geordnete Welt der Gesellschaft eindringt.
Die Resource ist eine domestizierte, in ihren Dimensionen der menschlichen
Vorsorge unterworfene Quelle von Flüssigem. Seit 1750 wurde der
Begriff der Ressource, im Einklang mit den historisch gegebenen
Nutzungen, auf wechselnde Teile der Wirtschaftsumwelt angewendet.
Von 1750 bis 1850 war der Boden mit seinen Früchten Quelle der wirtschaftlichen
Wertschöpfung. Von 1800 bis 1900 trat die menschliche körperliche
Arbeitskraft an seine Stelle. Im 20. Jahrhundert wurde erst Maschinenkapital,
dann die Leistungsfähigkeit menschlicher Bewußtseine (Humankapital)
zur primären Ressource. So werden die primären Ressourcen offenbar
aus Systemen bezogen, die auf zunehmend voraussetzungsvolleren Emergenzniveaus
operieren.
Die zweite Entwicklung verläuft über den Begriff des "surplus".
Verschiedene Umweltbestandteile - Ressourcen im eben besprochenen
Sinn - werden im Verlauf ihrer produktiven, also auf Zahlung gerichteten
Verwendung des öfteren bewertet: als Getreide, als Mehl und als
Brot beispielsweise. Die Differenzen zwischen den bezahlten Tauschwerten
werden beobachtet und als "overplus", später als "surplus"
bezeichnet. Der Überfluß wird so in der Form des Tauschwerts sogar
quantifizierbar und im Konstrukt des Sozialprodukts aggregierbar.
Man sieht diesen beiden Beschreibungssträngen an, daß sie sich nicht
auf Unterschiedliches, sondern auf je eine der beiden Seiten des
Transaktionserereignisses beziehen. Die fremdreferentielle Ressource,
die flüssig gemacht wird, ist die selbe, die auf der selbstreferentiellen
Innenseite als monetär meßbare Wertveränderung oder "Mehrwert"
auftaucht.
So spielte der Überfluß in verschiedenen Interpretationen noch
eine wichtige Rolle in den Diskussionen des 18. Jahrhunderts. Im
19. Jahrhundert war davon kaum mehr die Rede. Die Einsicht, daß
Wirtschaft über Knappheit kommuniziert und sich so vom Rest der
Gesellschaft unterscheidet, brach sich Bahn. Wenn der Begriff auftauchte,
dann eher im Zusammenhang mit Verschwendung, also einer Verwendung
von Gütern, die bei anderer Entscheidung flüssig gemacht werden
könnten. Dementsprechend erschien die Munifizenz barocker Fürsten
in einem anderen Licht: deren Prachtentfaltung war nicht länger
Symbol ihrer Versorgungskompetenz, sondern Zeichen ihrer Unfähigkeit,
an der Knappheitskommunikation teilzunehmen. In jüngerer Zeit tritt
dazu eine weitere Konnotation von Überfluß: Überfluß als etwas,
das nicht notwendig oder gar lästig ist (Bude
1998). Das Lästige wird in die "Umwelt" verwiesen:
Überflüssige Stoffe und Menschen liegen außerhalb der Unterscheidung
zwischen Knappem und Flüssigem, mittels derer die Wirtschaft sich
selbst reproduziert.
Damit ist die Entwicklung der Selbstausgrenzung der Wirtschaft
keineswegs abgeschlossen. Evolutionäre Prozesse sind nie abgeschlossen,
sie wechseln höchstens ihre Form. Der gegenwärtige Stand der Entwicklung
ist der, daß Überfluß sich zwar in Form von "Umwelteffekten"
bemerkbar macht, daß aber ansonsten die Unterscheidung zwischen
knappen Zahlungen und flüssigen Ressourcen immer besser funktioniert.
Das Bankennetz und die Finanzmärkte versorgen die Wirtschaft mit
immer noch wachsender Leistungsfähigkeit. Geld- und Währungsmedien
sind inzwischen weltweit institutionalisiert. Organisationen wie
die BIZ, der IMF und die EZB koordinieren zwischen Währungsräumen.
Die Börsenmärkte für Unternehmensanteile und Finanztitel bewegen
sich täglich rund um den Erdball. Die Ressourcen, bislang noch eingebettet
in Traditionen und staatliche Regeln, folgen den Zahlungsmöglichkeiten
ohne Rücksicht auf territoriale und kulturelle Grenzen. Das Wirtschaftssystem
hat begonnen, den schützenden und beschränkenden Rahmen nationalen
Rechts und nationaler Gewalt zu sprengen. Die Wirtschaft wird zum
eigentlichen globalen Spiel, innerhalb dessen sich politischnationale
Systeme wie Inseln abheben werden. Die tiefgreifendste Veränderung
wird von der Ausbreitung des globalen elektronischen Kommunikationsnetzes
Internet ausgehen. Im Netz werden neue Formen von Zahlungsmitteln
entstehen, die sich endgültig der territorialpolitischen Herrschaft
entziehen (Hughes 1995). Die
Wirtschaft entwickelt sich also nicht in Richtung einer stärkeren
Abgrenzung vom Rest der Gesellschaft, sondern in Richtung einer
netzartigen Durchdringung der Gesellschaft mit Hilfe von Netzwerkgeldmedien
und Bankennetzen.
Die kommunikative Vernetzung verändert auch die Fremdreferenz der
Transaktionen. Die Kommunikationskanäle der one-way (Radio, TV,
Video, Film) und der two-way (Telefon, Internet) - Medien werden
ständig technisch verfeinert, sodaß sich immer größere Bevölkerungsgruppen
am Senden und Empfangen immer komplexerer Informationen beteiligen
können. Die neuen Kanäle füllen sich mit Inhalten. Die Inhalte müssen
zwei Bedingungen erfüllen: sie müssen in digitalisierte Informationselemente
auflösbar sein, und sie müssen als Mitteilungen verständlich sein.
In der frühen Phase der Verwendung solcher Medien ging man davon
aus, daß mit Hilfe der Kanäle äußere Wirklichkeit übertragen wird,
etwa durch "Nachrichten" oder "Konzertübertragungen".
Heute weiß man, daß Inhalte und Programme zu großen Teilen in den
Kommunikationssystemen und ihren Organisationen unmittelbar erzeugt
werden. So entsteht die neue Klasse der "Informationsgüter".
Daraus läßt sich die Vermutung ableiten, daß die Kommunikationssysteme
in naher Zukunft an die erste Stelle unter den zu verflüssigenden
Ressourcen rücken werden. Sie konstitutieren die Umwelt, gegen die
sich das Kommunikationssystem Wirtschaft abgrenzen wird, indem es
sich an sie koppelt. In den Kommunikationssystemen entsteht eminent
Flüssiges, sogar digital Auflösbares, nämlich Information. Sie entsteht
in Formen der Darstellung und Selbstdarstellung, zu Zwecken der
Unterhaltung, der Wissensvermittlung, der Repräsentation usw.. Die
Kommunikationssysteme liefern die knappen Ressourcen, aus denen
Informationsgüter gefertigt werden: Game shows, Software, Werbekampagnen,
online-Zeitungen, Auktionsveranstaltungen, Finanzdienste usw.
Die Wirtschaft der Zukunft wird also in der Lage sein, die Gesellschaft
zunehmend mit derartigen Gütern zu versorgen. Damit verschwinden
Nahrungsmittel, Arbeit, Maschinen und Kompetenz nicht als knappe
Ressourcen. Aber ihr Anteil am Gesamtvolumen der monetär bewerteten
Transaktionen wird zurückgehen. Der Vorgang der Kommunikationssystemnutzung
hat die Phase seines exponentiellen Wachstums erst begonnen. Er
wird, soweit man derlei Entwicklungen vorhersagen kann, der wirtschaftlichen
Selbstreproduktion des kommenden Jahrhunderts den größten Teil der
Ressourcen liefern, die sie für ihre Wertschöpfung benötigt.
Die Umstellung auf Kommunikationsressourcen bringt allerdings Probleme
für das eingeübte Verständnis von Knappheit. Informationsgüter sind
Kommunikationsmediengüter und bestehen aus digitalisierter Information.Wenn
der Aufwand ihrer Erfindung und Konfiguration einmal erbracht ist,
können sie unendlich oft zu geringen Kosten reproduziert werden.
Knappheit läßt sich dann nicht mehr auf die Güter selbst zurechnen.
Sie muß, mit beträchtlichem rechtlichem und politischem Aufwand,
durch Schutzrechte künstlich erzeugt werden, oder sie wechselt auf
die Nachfragerseite: die Aufmerksamkeit der Nutzer wird als der
eigentliche Engpaßfaktor thematisiert (Franck
1998).
Kandidaten für eine genauere Beobachtung der von ihnen generierten
Mediengüter sind vor allem die Systeme Wissenschaft, Erziehung,
Massenmedien und Kunst, mitsamt der Organisationen, die in ihnen
die Informationsgüter schaffen. In jedem dieser Systeme findet gegenwärtig
eine rege Diskussion über die "Kommerzialisierung" ihrer
Inhalte statt. Was das Recht angeht, so sind die Entwicklungstendenzen
unklarer. Während die global players der Wirtschaft glauben, die
Weltgesellschaft zu dominieren, werden in politischen und wirtschaftlichen
Organisationen die Schlüsselstellen von Juristen besetzt. Entsprechend
werden nationale und auch internationale Verhandlungen zunehmend
in rechtlicher Codierung, und damit Logik, geführt. Dem Recht scheint
es also besser als den genannten Systemen zu gelingen, sich der
Rekonstruktion als externe knappe Ressource zu entziehen. Das Rechtssystem
wird vielmehr interner Bestandteil der Wirtschaftscodierung selbst.
Es hilft der Wirtschaft bei der Konstitution von Knappheit in ähnlicher
Weise, wie es bislang dem politischen System bei der Konstitution
von Herrschaft geholfen hat.
4. Ergebnis
und Ausblick
Die Untersuchung hat folgendes Bild der Entstehung der Knappheitscodierung
ergeben: In den älteren Funktionssystemen Religion und Herrschaft
grenzten sich Märkte aus, in denen Verständigung über Tauschwerte
stattfand. Die Abweichung von der göttlichen oder gesellschaftlichen
Ordnung wurde als "Überfluß" konnotiert. Damit war eine
Unterscheidung im unmarked space der Gesellschaft plaziert. Die
noch von äußeren Gegebenheiten angetriebenen Marktereignisse bildeten
eine spezifische Medienumgebung der Geldformen, insbesondere der
Metallgeldformen. In der Beobachtung der Geldverfügbarkeit, also
im Unterschied zum Überfluß, entstand die Erfahrung der Knappheit.
Knappheit wurde zur Eigenschaft wirtschaftlicher Güter. Die Unterscheidung
war umgeklappt, Knappheit bezeichnete nun die Innenseite der Wirtschaftsunterscheidung,
Überfluß die Außenseite. Der Profitzirkel begann, die Zahlungen
selbständig voranzutreiben. In den folgenden Jahrhunderten veränderte
die nun selbstreproduzierende Wirtschaft wiederum ihre Umwelt: Die
Außenwelt der Wirtschaft wurde unterschieden in flüssige und überflüssige
Bestandteile. Als flüssige Bestandteile fungierten im Lauf der vergangenen
300 Jahre unterschiedliche Ressourcen auf zunehmend höheren Emergenzniveaus.
Zur Zeit sind andere Kommunikationssysteme dabei, die primären Ressourcen
zur Versorgung der Gesellschaft liefern.
Soviel zu den Belegen für die beiden eingangs aufgestellten Thesen.
Die Entwicklung, die hier verkürzt dargestellt wird, ist dabei keineswegs
zwangsläufig. Im Gegenteil, das Ziel der Recherche lag gerade darin,
der Vorstellung von der Entstehung ausdifferenzierter Funktionssysteme
ihre Zwangsläufigkeit zu nehmen. Die für die selbstreferentielle
Operation notwendigen Paradoxa etablieren sich nur langsam, mit
territorial unterschiedlicher Stabilität und nur im Kontext dauernder,
evolutionär kontingenter Variationen und Selektionen der verwendeten
Mitteilungsformen. Das konnte am Beispiel der "Markttransaktionen",
also der Wirtschaftsereignisse, gezeigt werden.
Für die zukünftige Beobachtung der sich weiter ausdifferenzierenden
Wirtschaft stellt sich die Frage, ob das Verhältnis der global vernetzten,
finanziell autonomen Wirtschaft zu ihren neuen Informationsressourcen
mit dem traditionellen wirtschaftstheoretischen Instrumentarium
analysierbar sein wird. Schon die Berücksichtigung psychischer Kompetenz
konnte nur unbefriedigend als "Humankapital" oder "unternehmerische
Kreativität" erfaßt werden. Der Versuch, die strukturelle Kopplung
der Wirtschaft mit den sie umgebenden Kommunikationssystemen zu
beobachten, bringt weitere Schwierigkeiten mit sich, die systemtheoretisch
beschrieben, aber nicht einfach bewältigt werden können. Das grundsätzliche
Problem läßt sich folgendermaßen beschreiben: Wenn mithilfe eines
Kommunikationssystems, der Wissenschaft, das Verhältnis von zwei
anderen Kommunikationssystemen beobachtet wird, dann steht das Verhältnis
von drei gleichzeitig operierenden Codierungen in Frage. Die Situation
des Wissenschaftlers war bei der Beobachtung materieller Produktion
und Konsumtion einfacher: Das, was gehandelt wurde, war nicht seinerseits
über einen kommunikativen Code organisiert. Blieb also nur noch
das Verhältnis von wissenschaftlicher zu wirtschaftlicher Codierung,
und das wurde über die IneinsSetzung von wissenschaftlicher und
wirtschaftlicher Rationalität neutralisiert (Hutter/Teubner
1994).
Jetzt bringt die Thematisierung der Kommunikationssystemnutzung
oder -verflüssigung gleich beide Schwierigkeiten mit sich: zum einen
läßt sich die Eigencodierung der genutzten Systeme nicht mehr ignorieren(18).
Zum anderen gerät die Eigencodierung der Wissenschaft zwangsläufig
mit in den Blick. Mit beiden Schwierigkeiten wird sich die systemtheoretische
Rekonstruktion der Wirtschaft und ihrer Umwelten auseinandersetzen
müssen.
Prof. Dr. Michael Hutter, Lehrstuhl für Theorie der
Wirtschaft und ihrer Umwelt
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Universität Witten/Herdecke
Alfred Herrhausen-Str. 50, D-58448 Witten
iwk@uni-wh.de

|