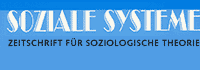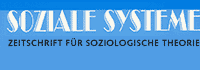Zusammenfassungen
Im Jahre 1989 erschien das Buch ”Reden und Schweigen” als das Resultat
einer langjährigen Zusammenarbeit von Niklas Luhmann und Peter Fuchs.
Die hier erstmals publizierten Notizen geben einen Eindruck
davon, wie diese Zusammenarbeit abgelaufen ist. Sie sind, das versteht
sich von selbst, in vielem vorläufig, sie zeigen das Ausprobieren
von Denkfiguren und einen Denkstil, einen beweglichen, geschmeidigen,
pathosfreien Stil, dem man die Werkstatt noch ansieht, aber der
sehr oft schon ins Druckreife überging.

Zusammenfassung: Die Arbeit stellt eine anfängliche, aber doch
radikale Auseinandersetzung mit einem Stil soziologischen Denkens
dar, der in Frankreich bestimmend ist und dadurch zur Blockierung
alternativer gesellschaftstheoretischer Stile beiträgt. Es geht
um die Sozioanthropologie der Gabe (le don), die sehr schön an die
"faits sociaux totaux" Durkheims anschließt und eine starke
Verfestigung der soziologischen Grundkategorie des Symbolischen
zur Folge hat. Die massive Kryptonormativität der französischen
Soziologie gründet in der Kanonisierung der Kategorie des "symbolischen
Austauschs" (échange symbolique), an deren Befestigung der
Strukturalismus beigetragen hat. Daß unsere ausdifferenzierten Gesellschaften
ohne diese Dimension des Symbolischen auskommen, ja vielleicht gerade
aus dem Verzicht auf eine solche einen Teil ihrer Dynamik schöpfen,
entgeht jener Soziologie völlig. Das Festhalten an jener Grundkategorie
schlägt sich in ein Defizit der analytischen Pertinenz und einer
verwirrenden, weil in jede Richtung (sowohl des Humanismus als auch
des Antihumanismus) biegbaren, konstanten moralisch-kritischen Einstellung
nieder.
Die Arbeit geht von einer höchst aktuellen, für den Argumentationsstil
der französichen Intellektualität besonders kennzeichnenden Debatte
aus, der um das Contrat d'union Sociale (CUS) – das nach längerem
Wanken in der Terminologie PACS (PActe Civil de Solidarité) heißen
soll. Die Soziologin Irène Théry ist von der französischen Regierung
mit der Verfassung eines Rapport beauftragt worden, der heute vorliegt
und als Grundlage für die gesetzgeberische Arbeit benutzt wurde.
Meine Besprechung der Analysen und Stellungnahmen dieses Rapports
ist Ausgangspunkt für die Thematisierung der Funktionsweise des
kritischen Diskurses der zugrundeliegenden Soziologie. Es ergeben
sich Einsichten in die Ambiguität einer kritisch-libertären Soziologie,
die sich gleichzeitig der normativen Kategorie der symbolischen
Reziprozität verpflichtetet wissen will. Die Arbeit stellt weniger
auf positive Analysen der gesellschaftlichen Systemdifferenziertheit
ab als auf die Aufdeckung der Entfernung, die uns von den substanziellen
symbolischen Quellen gemeinschaftlichen Handelns trennt.
Hierzu werden Kontrastvorstellung aus heutigen Gesellschaften
berufen, in denen noch solche substantielle Symbolik, residuell
aber deswegen vielleicht um so vehementer, lebendig ist. Am Beispiel
der Speisung des islamischen Strafrechts (der hudûd) mit dieser
Symbolik wird eine soziologische Beschreibung der symbolisch-affektuellen
Absicherung von nicht relativierbaren Verboten entwickelt. Von hier
aus lassen sich die typischen Prozesse der Desymbolisierung verdeutlichen,
welche mit der funktionalen Differenzierung unserer Gesellschaften
einhergehen. Die Latenz des Symbolischen in diesen Gesellschaften
scheint dann sehr schwer aufhebbar.

Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht die Börse als paradigmatischen
Fall eines organisierten Marktes. Dieser Markt faßt das Emergenzproblem
des Preises, das Organisationsproblem anarchischer Koordination
und das Zeitproblem der Spekulation auf die Differenz von Vergangenheit
und Zukunft in das diese Teilprobleme zugleich lösende Problem der
Kommunikation von Risiken zusammen. Eine systemtheoretische Analyse
zeigt, daß die Börse von Zahlungsentscheidungen reproduziert wird,
denen die Logik der Risikowette zugrundeliegt. Diese Logik unterscheidet
Ereignisse, auf die gewettet wird, von anderen, störenden Ereignissen.
Sie unterscheidet den, der wettet, vom Lauf der Ereignisse, auf
den gewettet wird. Und sie unterscheidet den Wettenden von denjenigen,
die ihn beobachten und ihrerseits Wetten darauf abschließen, wessen
Wetten aussichtsreich scheinen. Diese Logik ist zirkulär gebaut
und ist im Milieu der modernen Wirtschaft, ihrer Märkte und Organisationen
in der Lage, jene sachliche, zeitliche und soziale Komplexität zu
generieren, die die Börse typischerweise aufweist.

Zusammenfassung: Der Beitrag entwirft einen soziologischen Rahmen
zum Verständnis des Fortbestandes ethischer Konflikte und Kontroversen
in der gegenwärtigen Gesellschaft. In der Theorie funktionaler Differenzierung
wird die gesellschaftliche Bindungskraft der Moral auf die Kommunikation
interpersonaler Achtung eingegrenzt. Die Theorie hat dann Schwierigkeiten
mit der Verarbeitung der beobachtbaren Zunahme an moralisch diskutierten
und von ethischen Experten verhandelten Problemen in sozialen, kulturellen
und ökologischen Kontexten. Es wird ein Model entwickelt, das einerseits
in den Funktionssystemen ethische Institutionen zur Verteidigung
spezieller Funktionswerte gegen übergreifende Moralforderungen lokalisiert,
und andererseits von der Wirksamkeit des moralischen Protests von
Solidargruppen ausgeht. Die Flexibilität einer Gesellschaft, die
ständig Modernisierung betreibt, hängt davon ab, ob sie die Spannungen
zwischen institutioneller Moral und Protestmoral in diskursiven
Konflikten verarbeiten kann.

Zusammenfassung: Die Rechtstheorie Niklas Luhmanns enthält mehrmals
ausdrückliche Verweise auf Walter Benjamins Essai "Zur Kritik
der Gewalt". Bei beiden Autoren hat das Thema der Gewalt seinen
Platz. Sie beschreiben die physische Gewalt als Phänomen auf der
Schwelle einer Ordnung, die gewaltsam gestiftet, erhalten und im
Grenzfall durch Gewalt durchbrochen wird. Beide Theorien konfrontieren
sich auf ihre Weise mit der Unmöglichkeit, die Gewalt als Ereignis
innerhalb der normativen Ordnung, aber auch der kommunikativen,
der historischen, der Wahrnehmungsordnung zu denken. Der Aufsatz
umreißt die Gewaltkonzeptionen bei Benjamin und Luhmann und skizziert
die erkenntnistheoretischen Aporien. Beide Autoren versetzen das
Thema in die Nähe einer zeittheoretischen Problematik - der Frage
der Unmittelbarkeit, des 'reinen' Ereignisses, der nicht temporalisierten
Gleichzeitigkeit der Gegenwart. Mit systematischen Überlegungen
schließt der Aufsatz hier an. Vorgeschlagen werden Grundlinien einer
zeittheoretischen Annäherung an das Gewaltphänomen.

Zusammenfassung: Der Begriff "Großtechnisches System"
wird vorzugsweise für technisch vernetzte Infrastruktursysteme benutzt.
Als Kriterien einer Bestimmung dienten bisher die Ausbildung netzwerkartiger
Strukturen, eine weite geographische Ausbreitung und erhebliche
Kapitalintensität. Eine genauere begriffliche Klärung oder eine
hinreichende Theorie konnten noch nicht entwickelt werden. Die Diskussion
orientierte sich an historischen Einzelfällen, ohne die funktionalen
Besonderheiten der jeweiligen Referenztechniken zu berücksichtigen.
Im Rahmen einer Theorie funktionaler Differenzierung werden in diesem
Beitrag die klassischen großtechnischen Systeme wie Eisenbahn, Telekommunikation
und Stromversorgung untersucht. Dabei werden Kategorien einer funktionalen
und technischen Notwendigkeit zur Systembildung unterschieden. An
drei Beispielen wird gezeigt, daß dieser Ansatz implizit schon vorhandene,
begriffliche Differenzierungen der Theorie großtechnischer Systeme
offenzulegen vermag. Die funktionale Perspektive macht außer den
bisherigen Vorhersagen eines stetigen Wachstums auch die Möglichkeit
einer Dezentralisierung im Funktionsbereich der großtechnischen
Systeme sichtbar.

Zusammenfassung: Der Aufsatz versucht zu zeigen, daß die epistemologischen
Voraussetzungen der Systemtheorie weitreichende Konsequenzen für
die empirische Forschung haben, die schon dem Werk Luhmanns zu entnehmen
sind. Nach Luhmann kann jeder Beobachter, sei dies in Theorie oder
Methode, sich nur auf die Realität beziehen, ohne diese aber als
solche erfassen zu können. Es kollabiert also jene Unterscheidung
von Theorie/Empirie, die auf beiden Seiten einen privilegierten
Zugang zur Realität postuliert. Der operative Konstruktivismus und
der damit verbundene Imperativ, operierende beobachtende Systeme
zu beobachten, impliziert die Möglichkeit, die von Systemen zur
Beobachtung eingesetzten Unterscheidungen zu beobachten. Für Wissenschaft
bedeutet dies u.a., die verwendeten Theorien und Methoden zu beobachten
und zu bewerten. Theorie und Methode schränken sich gegenseitig
ein: Beide sind kontingente Konstruktionen eines Beobachters, da
sie sich aufeinander abstimmen müssen, dürfen sie aber nicht beliebig
sein. Aus dieser Beobachtung empirischer Systeme der systemtheoretischen
Forschung resultieren Erkenntnisse darüber, welche Methoden für
die systemische Gesellschaftstheorie tauglich sind. Diese können
auf der Ebene der Datenerhebung hauptsächlich im Hinweis gesehen
werden, Kommunikation statt Individuen und Unterscheidungen statt
Variablen zu beobachten; auf der Ebene der Techniken der Datenanalyse
konkretisieren sie sich mit Bezug auf die funktionale Methode.

|